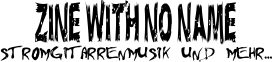

„Let's listen to the
colours of our dreams"
(frei nach BEATLES - Tomorrow never
knows)
 Die
letztjährige Herbstmusik hatten wir mit der Band Elder eingeleitet, die
auch diesmal wieder dabei sind – wenn auch in abgewandelter Form. Die
Amis haben sich mit der Band Kadavar zusammengetan und das Resultat
dieser deutsch-amerikanischen Freundschaft trägt den Namen ELDOVAR. Vor
zwei Jahren erschien das vorliegende Album, das den Versuch antrat,
Musiker aus zwei Gruppen ein neues, funktionsfähiges Ganzes erschaffen
zu lassen. Das Unterfangen ist hörbar geglückt und bietet eine
kurzweilige Dreiviertelstunde lang eine sehr angenehme Mischung, die
von Post- und Krautrock-Elementen bis zu Passagen reicht, in denen
leicht erkennbar und ausgiebig PINK FLOYD zitiert werden.
Die
letztjährige Herbstmusik hatten wir mit der Band Elder eingeleitet, die
auch diesmal wieder dabei sind – wenn auch in abgewandelter Form. Die
Amis haben sich mit der Band Kadavar zusammengetan und das Resultat
dieser deutsch-amerikanischen Freundschaft trägt den Namen ELDOVAR. Vor
zwei Jahren erschien das vorliegende Album, das den Versuch antrat,
Musiker aus zwei Gruppen ein neues, funktionsfähiges Ganzes erschaffen
zu lassen. Das Unterfangen ist hörbar geglückt und bietet eine
kurzweilige Dreiviertelstunde lang eine sehr angenehme Mischung, die
von Post- und Krautrock-Elementen bis zu Passagen reicht, in denen
leicht erkennbar und ausgiebig PINK FLOYD zitiert werden.
Schon im ersten Track, der deutlich die Neun-Minuten-Grenze hinter sich
lässt, präsentiert das Album seine Stärke: Da dröhnt sich niemand trotz
der Länge ins schier unendliche, indifferente Nichts, das ist schlüssig
aufgebaut und wirkt nicht langweilig. Track 2, das halbakustische „In
the Way“, lässt Erinnerungen an die dritte LP von LED ZEPPELIN
aufkommen, was nun keine schlechte Inspirationsquelle darstellt.
Sphärischer und auch etwas elektronisch angereichert wird es in „El
Matador“ mit einem guten Gespür für schöne Melodien, die nicht kitschig
klingen.
Erfreulich ist auch die Tatsache, dass der Abwechslungsreichtum hier
nicht zu kurz kommt, was im Bereich Post-Rock und Artverwandtem ja
durchaus ein Problem sein kann, wenn die Musik irgendwann doch zu
gleichförmig um sich selbst kreist. ELDOVAR wirken dem entgegen, wenn
z. B. ein dunkel grummelnder Keyboard-Teppich vom straff arrangierten
Elfminüter „Blood Moon Night“ abgelöst wird. Das längste Stück auf dem
Album hat selbst für einen nicht bis ins Knochenmark hinein mit PINK
FLOYD-Expertenwissen ausgestatteten Hörer wie mich deutliche Anklänge
an die berühmten britischen Kollegen, aber kaum hat man die Zitate
ausgemacht, dreht die Band ungeniert an der Heaviness-Schraube und
begibt sich in Bereiche, die auch einer musikalisch härter angelegten
Doom-Kapelle ausgesprochen gut zu Gesicht stehen würden.
Nach einem entspannten Ausklang mit Klavierbegleitung bleibt
festzuhalten, dass dieses Album definitiv noch öfter laufen wird, die
musikalische Klasse ist einfach überzeugend. Für die Vinyl-Freunde gibt
es in diesem Fall diverse Auflagen (gefühlte 20, tatsächlich wohl kaum
weniger), was für meinen Geschmack langsam ein wenig ausufert. Musik
muss als Tonträger mittlerweile wohl in erster Linie über
Besonderheiten bei der Verpackung oder auf ähnlichen Ebenen verkauft
werden, um dann online in Sammlerforen mitteilen zu können, dass man
gerade eben die auf 250 Einheiten limitierte LP im „Red Cloudy“-Vinyl
erstanden hat. Wer es konventioneller mag: Eine CD gibt's hiervon
ebenfalls, immerhin in einer Auflage von 1000 Exemplaren.
- Stefan- 10/2023
 Ein enorm stimmungsvolles Covermotiv ziert dieses Album und
es war wohl auch der Grund, mir seinerzeit in den ausgehenden
Achtzigern aus der mit harter Rockmusik eher überschaubar
ausgestatteten Stadtbibliothek eine Kassette der Band BLUE ÖYSTER CULT
auszuleihen. Mein Interesse galt schon mehr dem härteren Metal, aber
gehört wurde trotzdem (und auch heute noch) stilistisch vieles
durcheinander. Grönemeyer und Napalm Death? Das ging beides, wenn auch
nicht unbedingt parallel laufend.
Ein enorm stimmungsvolles Covermotiv ziert dieses Album und
es war wohl auch der Grund, mir seinerzeit in den ausgehenden
Achtzigern aus der mit harter Rockmusik eher überschaubar
ausgestatteten Stadtbibliothek eine Kassette der Band BLUE ÖYSTER CULT
auszuleihen. Mein Interesse galt schon mehr dem härteren Metal, aber
gehört wurde trotzdem (und auch heute noch) stilistisch vieles
durcheinander. Grönemeyer und Napalm Death? Das ging beides, wenn auch
nicht unbedingt parallel laufend.
Die vorliegende Band war zwar durch einige Classic-Rock-Hits bekannt (an erster Stelle natürlich „Don’t fear the Reaper“, was sonst), aber in dieser Zeit nicht mehr auf dem Zenit ihrer Popularität, die sich in den Siebzigern noch auf einem anderen Level bewegt hatte. Heute dagegen scheinen mir BÖC auch in Metal-Kreisen wiederentdeckt worden zu sein und spielten dieses Jahr im Sommer unter anderem beim beliebten „Sweden Rock“-Festival.
Die Entstehungsgeschichte von
„Imaginos“ ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Da ist von einer
langen Produktionsdauer die Rede und von einer ganzen Kompanie an
Gastmusikern. Das inhaltliche Konzept hinter dem Album steht dem in
nichts nach. Zieht man den englischsprachigen Wikipedia-Eintrag zu
Rate, reicht „Imaginos" textlich bis in die Sechziger zurück und
entwirft eine versponnene Gothic/SF-Geschichte, die an dieser Stelle
kaum wiederzugeben ist. „A BEDTIME STORY FOR THE CHILDREN OF THE
DAMNED" heißt es auf dem Backcover und damit ist der Rahmen abgesteckt.
BLUE ÖYSTER CULT bewegten sich damit deutlich abseits des
Achtziger-US-Hardrocks, wo seinerzeit gerne Herren und Damen mit
hochtoupierten Frisuren unterwegs waren und sich in Videoclips Models
auf Motorhauben von Luxusautos räkelten (so rufe ich mir das zumindest
für den Moment als verdichtetes Klischeebild in Erinnerung).
Ursprünglich sollte "Imaginos" ein Soloalbum des BÖC-Drummers werden,
dann uferte das Unternehmen in einem acht Jahre währenden
Schaffensprozess aus. Da liegt natürlich der Gedanke an die vielen
Köche, die den Brei nachhaltig verderben, sehr nahe. Die mehrteilige
Rock-Oper, die einmal geplant gewesen war, blieb dabei irgendwann auf
der Strecke und es wurde bis zur Veröffentlichung auch noch viel daran
herumgedoktert. An der kommerziellen Front soll das Album kein Erfolg
gewesen sein, es bot sich auch wenig Greifbares etwa für eine mögliche
Hitsingle an. Betrachtet man die Scheibe aber mal ganz losgelöst vom
Bandkontext und den Querelen der Produktionsphase, ist sie dennoch eine
Wiederentdeckung wert.

Der Sound mag überproduziert wirken und
man könnte sich das Gebotene auch erdiger, reduzierter vorstellen, doch
das mag der umfangreichen Beteiligung von gefühlt 538 Sessionmusikern
geschuldet sein. Behält man aber während des Hörens das fantastische
Cover-Artwork im Auge, transportiert sich auch im Hochglanz-Hardrock
eine spannungsgeladene, mysteriöse Atmosphäre. „In the Presence of
another World" lautet ein dazu passend betiteltes Highlight des Albums,
das sich diese Stimmung über weite Strecken bewahrt (das etwas käsige
„Del Rio’s Song“ ist stilistisch ein kleiner Ausreißer). Gelegentlich
wird BÖC nachgesagt, in dieser Zeit dem Metal am nächsten gekommen zu
sein, was bei Songs wie „The Siege and Investiture of Baron von
Frankenstein's Castle at Weisseria“ (was für ein Titel!) hörbar wird,
wenn man sich die Chorgesänge mal weg- und den Gesang von Tony Martin
(in seiner BLACK SABBATH-Phase) dazudenkt.
Da ich bestimmt kein Experte auf dem Gebiet BLUE ÖYSTER CULT bin, würde
ich erst gar nicht den Versuch unternehmen wollen, dieses Album im
Gesamtwerk kompetent einzuordnen. Songs wie „Magna of Illusion“ oder
die oben genannten versprühen ein angenehmes Schauergeschichten-Flair
und die gelungene visuelle Gestaltung der LP lässt „Imaginos" zu einem
dieser Alben werden, die im unmittelbaren zeitlichen Kontext
künstlerisch wie kommerziell zwar in die Beinahe-Flop-Ecke gerückt
wurden, in ihrer eigenen Nische dann aber über Jahrzehnte weiterleben.
Auf klassischen Tonträgern ist momentan offenbar nichts „in print“,
aber diesem Zustand könnte ja durch eine Neuauflage auf CD und Vinyl
begegnet werden.
- Stefan - 10/203

 Ähnlich wie beim Post-Rock gibt’s ja auch gegenüber dem
Shoegaze-Genre gelegentlich das Vorurteil, dass die Musiker einfach nur
ereignisarm vor sich hin schrammeln, sich in bedeutungsschwangerer
Nichtigkeit verlieren. Das ist natürlich nicht zutreffend und kann
entstehen, wenn man mit konservativen Vorstellungen davon, was denn nun
einen guten Rocksong ausmacht, an diese Spielart herangeht. Die Briten
SLOWDIVE, die vor 30 Jahren ihre zweite LP „Souvlaki“ veröffentlichten,
ließen schon damals handelsübliche Zutaten einfach weg: keine
prägnanten Riffs, keinen Strophe-Refrain-Aufbau, keine ausgefeilten
virtuosen Soli zur Selbstdarstellung.
Ähnlich wie beim Post-Rock gibt’s ja auch gegenüber dem
Shoegaze-Genre gelegentlich das Vorurteil, dass die Musiker einfach nur
ereignisarm vor sich hin schrammeln, sich in bedeutungsschwangerer
Nichtigkeit verlieren. Das ist natürlich nicht zutreffend und kann
entstehen, wenn man mit konservativen Vorstellungen davon, was denn nun
einen guten Rocksong ausmacht, an diese Spielart herangeht. Die Briten
SLOWDIVE, die vor 30 Jahren ihre zweite LP „Souvlaki“ veröffentlichten,
ließen schon damals handelsübliche Zutaten einfach weg: keine
prägnanten Riffs, keinen Strophe-Refrain-Aufbau, keine ausgefeilten
virtuosen Soli zur Selbstdarstellung.
An deren Stelle traten fließende Strukturen mit Ambient-Charakter, die
den Zustand zelebrieren und nicht das Abgeschlossene, das prägnant etwa
auf den Einsatz im Radio Zugeschnittene. Auch wenn die einzelnen Stücke
gar nicht mal besonders lang sind und ausufernde Zehnminüter komplett
fehlen, sticht hier kaum ein Song heraus, der sich im Hinblick auf eine
klassische Single-Auskopplung anbieten würde. Die SLOWDIVE-Musik
verweigert sich doch ziemlich konsequent den Erfordernissen, die dazu
notwendig oder erwünscht wären.
 Trotzdem
entwickelt „Souvlaki“ schon bald einen Sog, der einen mitnimmt. Wer
stilprägende Gruppen wie MY BLOODY VALENTINE kennt, wird auch jenes
Gefühl kennen, wenn dieser charakteristische Gitarrensound zu schweben
beginnt und der sphärische Gesang einsetzt. Besondere Tracks
hervorzuheben, ist naturgemäß etwas schwierig, aber ich würde mal
spontan „When the Sun hits“ und „Melon Yellow“ auswählen, da sie die
Bandbreite des Albums ganz gut repräsentieren. Etwas aus dem Rahmen
fällt das abschließende „Dagger“ mit seinen akustischen Gitarren, die
an Folk-Elemente anknüpfen. Das alles ergibt am Ende einen Sound, der
auch in Metal-Fankreisen Anklang findet (als Gradmesser können die
Musik-Diskussionen im Deaf-Forever-Forum dienen) und beweist, dass auch
und gerade die Bands aus dem harten Sektor nicht selten über
weitläufigere Einflüsse verfügen, als man dem ersten Eindruck nach
vermuten könnte. Die Franzosen ALCEST etwa, als Post-Black-Metal
kategorisiert und große SLOWDIVE-Fans, hatten sogar deren Gitarristen
Neil Halstead auf ihrem Album „Shelter“ zu Gast. Und das ebenfalls
Bemerkenswerte eines Albums wie „Souvlaki“ ist der zeitlose Charakter
der Musik: Nichts deutet darauf hin, dass die Platte aus den frühen
Neunzigern stammt. Ihr fehlt alles Zeittypische und damit jedes
Verfallsdatum. In der richtigen Stimmung und in der richtigen
Jahreszeit klingt „Souvlaki“ vollkommen zeitlos und aktuell, als hätte
sich die Musik zugleich ihre eigene Welt erschaffen.
Trotzdem
entwickelt „Souvlaki“ schon bald einen Sog, der einen mitnimmt. Wer
stilprägende Gruppen wie MY BLOODY VALENTINE kennt, wird auch jenes
Gefühl kennen, wenn dieser charakteristische Gitarrensound zu schweben
beginnt und der sphärische Gesang einsetzt. Besondere Tracks
hervorzuheben, ist naturgemäß etwas schwierig, aber ich würde mal
spontan „When the Sun hits“ und „Melon Yellow“ auswählen, da sie die
Bandbreite des Albums ganz gut repräsentieren. Etwas aus dem Rahmen
fällt das abschließende „Dagger“ mit seinen akustischen Gitarren, die
an Folk-Elemente anknüpfen. Das alles ergibt am Ende einen Sound, der
auch in Metal-Fankreisen Anklang findet (als Gradmesser können die
Musik-Diskussionen im Deaf-Forever-Forum dienen) und beweist, dass auch
und gerade die Bands aus dem harten Sektor nicht selten über
weitläufigere Einflüsse verfügen, als man dem ersten Eindruck nach
vermuten könnte. Die Franzosen ALCEST etwa, als Post-Black-Metal
kategorisiert und große SLOWDIVE-Fans, hatten sogar deren Gitarristen
Neil Halstead auf ihrem Album „Shelter“ zu Gast. Und das ebenfalls
Bemerkenswerte eines Albums wie „Souvlaki“ ist der zeitlose Charakter
der Musik: Nichts deutet darauf hin, dass die Platte aus den frühen
Neunzigern stammt. Ihr fehlt alles Zeittypische und damit jedes
Verfallsdatum. In der richtigen Stimmung und in der richtigen
Jahreszeit klingt „Souvlaki“ vollkommen zeitlos und aktuell, als hätte
sich die Musik zugleich ihre eigene Welt erschaffen.
- Stefan - 10/2023
 Wer mit dem britischen Folk-Rock der Sechziger und
Siebziger so gar nicht vertraut ist, wird von Bands wie FAIRPORT
CONVENTION zumindest schon mal dem Namen nach gehört haben. Deren
Sängerin Sandy Denny wirkte auf dem vierten Album von LED ZEPPELIN mit
(„The Battle of Evermore“ wurde durch ihren Gesang veredelt). Die
vorliegende Scheibe war die vierte LP der Band, die in diesem Jahr
überaus produktiv war: 1969 hat gleich drei (!) FC-Veröffentlichungen
zu verzeichnen.
Wer mit dem britischen Folk-Rock der Sechziger und
Siebziger so gar nicht vertraut ist, wird von Bands wie FAIRPORT
CONVENTION zumindest schon mal dem Namen nach gehört haben. Deren
Sängerin Sandy Denny wirkte auf dem vierten Album von LED ZEPPELIN mit
(„The Battle of Evermore“ wurde durch ihren Gesang veredelt). Die
vorliegende Scheibe war die vierte LP der Band, die in diesem Jahr
überaus produktiv war: 1969 hat gleich drei (!) FC-Veröffentlichungen
zu verzeichnen.
„Liege & Lief“ stützt sich auf Traditionals und Eigenkompositionen,
die in ähnlichem Stil gehalten sind, was sehr gut harmoniert und keine
störenden stilistischen Brüche produziert. Fragiler war das Bandgefüge,
denn als das Album erschien, hatten Sandy Denny und Bassist Ashley
Hutchings die Gruppe bereits verlassen. Die LP erwies sich als
erfolgreich, auch wenn die Verkäufe sich eher stetig denn
strohfeuerartig entwickelten. Heute sind der Klassikerstatus und die
stilprägende Bedeutung unter Genrefans und Musikjournalisten
unbestritten.
Wie weit der Einfluss wirklich reicht, zeigt eine Band wie OFFA REX,
die wir vor einigen Jahren ebenfalls in der Herbstmusik zu Gast hatten.
Auch sie verarbeitet Traditionals auf ähnliche Weise, wenn man einmal
die Stücke „Matty Groves“ und „Blackleg Miner“ nebeneinander stellt,
wobei FAIRPORT CONVENTION mitten im Song das Tempo noch etwas anziehen
und ein rockiger Jam-Part den zweiten Abschnitt dominiert. Was noch
über der ohnehin hörenswerten Musik thront, ist Sandy Dennys großartige
Stimme, die sie weit über ihren allzu frühen Tod mit gerade einmal 31
Jahren hinaus bis heute in Erinnerung bleiben lässt.

Dennys Gesang erweist sich als sehr variabel, die ruhigen und
sanften Stücke funktionieren ebenso gut wie ein stärker an Rock
angelehnter Track wie „Tam Lin“, der im direkten Vergleich „härteste“
Song auf dem Album und (nach rein persönlichem Geschmack betrachtet)
auch dessen Höhepunkt. Hier vereinigen sich Folk und Rock zu einem
neuen Ganzen, da läuft die Band zu bestechender Form auf. Es ist nicht
einfach, etwas Großartigem danach etwas annähernd Gleichwertiges folgen
zu lassen und so hat das abschließende „Crazy Man Michael“ eine eher
undankbare Aufgabe, die der Song aber ohne Schwierigkeiten
meistert.
Wie bei einem derart hochgelobten Album üblich, gibt es auch hier eine
Menge an Veröffentlichungen, aus denen man auswählen kann. Es herrscht
kein Mangel sowohl an günstigen CD-Ausgaben wie auch an preislich höher
anzusetzendem Vinyl, wobei für Freunde des Bonusmaterials die in
diversen Ländern ausgewertete Doppel-CD besonders interessant sein
dürfte, auf der es neben dem Original-Album auch noch diverse Outtakes
zu hören gibt sowie Aufnahmen, die in Sessions für die BBC entstanden
waren.
- Stefan - 11/2023

 Jetzt
darf der Doom Metal ran: ELECTRIC WIZARD sind nach 30 Jahren zu einer
Größe in ihrer musikalischen Nische geworden, die klassischen
Black-Sabbath-Doom der Siebziger mit einer mysteriös-okkulten Aura nach
dem Vorbild ähnlich gestrickter Filme aus jener Zeit verbindet. Obwohl
auch in Fankreisen immer wieder mal Stimmen zu hören sind, dass der
Sound der Band auf Dauer doch etwas limitiert klänge und einige Alben
zu gewissen Abnutzungserscheinungen führten. Ist nicht falsch, eine
Überdosierung kann da schon eintreten und wahnsinnig abwechslungsreich
ist die Musik zum Teil ja nun nicht gerade, das muss man zugeben.
Jetzt
darf der Doom Metal ran: ELECTRIC WIZARD sind nach 30 Jahren zu einer
Größe in ihrer musikalischen Nische geworden, die klassischen
Black-Sabbath-Doom der Siebziger mit einer mysteriös-okkulten Aura nach
dem Vorbild ähnlich gestrickter Filme aus jener Zeit verbindet. Obwohl
auch in Fankreisen immer wieder mal Stimmen zu hören sind, dass der
Sound der Band auf Dauer doch etwas limitiert klänge und einige Alben
zu gewissen Abnutzungserscheinungen führten. Ist nicht falsch, eine
Überdosierung kann da schon eintreten und wahnsinnig abwechslungsreich
ist die Musik zum Teil ja nun nicht gerade, das muss man zugeben.
In der passenden Stimmung und Jahreszeit gehört funktioniert der Sound
aber für meine Ansprüche doch sehr ordentlich. „Witchcult Today“
beginnt gleich mit dem Titeltrack, garniert mit guten Riffs,
eingespielt von einer Besetzung, die schon seit etlichen Jahren wieder
Geschichte ist. Die Positionen Bass und Drums wurden immer wieder mal
ausgetauscht, der Kern der Band besteht aus Jus Oborn (git/voc) und
seiner Frau Liz Buckingham an der zweiten Gitarre. Im Zentrum der Musik
stehen die massiven Riffs, ausgefeilte Gesangsmelodien oder
Solo-Eskapaden treten eindeutig in den Hintergrund. Im Doppelpack
„Dunwich“ und „Satanic Rites of Drugula“ ist das ziemlich wirkungsvoll,
bevor das vergleichsweise kurze Instrumental „Raptus“ innehalten lässt.
 Stilistisch auf der bisherigen Linie liegt „The
chosen Few", das zielstrebig auf sein simples, effektives Hauptriff
zusteuert. Mit ordentlich Schalldruck im Rücken könnte man damit (falls
erwünscht) spätnachts auch noch seine Nachbarn mitversorgen.
„Torquemada ’71“ ist ebenfalls gelungen, lebt jedoch bei aller
Rifflastigkeit auch von seinem Refrain. Das eingangs erwähnte Faible
für Filme von 70er-Regisseuren wie Jess Franco oder Jean Rollin leben
ELECTRIC WIZARD im ausufernden instrumentalen Elfminüter „Black Magic
Rituals & Perversions“ aus, dessen erster Teil eine Coverversion
des Themas zu „Frisson des Vampires“ von Rollin ist (im Original damals
eingespielt von der französischen Band ACANTHUS). Eigentlich eine gute
Nummer, allerdings wabert die zweite Hälfte leider etwas ins Diffuse
hinein und wirkt eher lose improvisiert. Das hätte sich ohne
bedeutenden Verlust an inhaltlicher Substanz sicher auch etwas kürzer
gestalten lassen.
Stilistisch auf der bisherigen Linie liegt „The
chosen Few", das zielstrebig auf sein simples, effektives Hauptriff
zusteuert. Mit ordentlich Schalldruck im Rücken könnte man damit (falls
erwünscht) spätnachts auch noch seine Nachbarn mitversorgen.
„Torquemada ’71“ ist ebenfalls gelungen, lebt jedoch bei aller
Rifflastigkeit auch von seinem Refrain. Das eingangs erwähnte Faible
für Filme von 70er-Regisseuren wie Jess Franco oder Jean Rollin leben
ELECTRIC WIZARD im ausufernden instrumentalen Elfminüter „Black Magic
Rituals & Perversions“ aus, dessen erster Teil eine Coverversion
des Themas zu „Frisson des Vampires“ von Rollin ist (im Original damals
eingespielt von der französischen Band ACANTHUS). Eigentlich eine gute
Nummer, allerdings wabert die zweite Hälfte leider etwas ins Diffuse
hinein und wirkt eher lose improvisiert. Das hätte sich ohne
bedeutenden Verlust an inhaltlicher Substanz sicher auch etwas kürzer
gestalten lassen.
Ein bisschen schade, dass „Witchcult Today" auf der Zielgeraden
nachzulassen beginnt, das abschließende Stück "Saturnine" klingt
durchschnittlich und ist dafür mit seinen ebenfalls elf Minuten nicht
tragfähig genug. Über die volle Distanz des knapp einstündigen Albums
würde ich das allerdings als Schönheitsfehler betrachten wollen, der
Rest der Scheibe hat seine definitiv seine Stärken, die auch
überwiegen. Das Schreiben gelungener Riffs kann man der Band nicht
absprechen und davon lebt sie schließlich. Vermutlich ist das auch eine
Musik, die vom Live-Erlebnis lebt, bei dem man mit ordentlicher
Lautstärke und trotzdem ausreichend differenziertem Sound von der
Doom-Walze rundumversorgt wird. Auf Konserve wie hier ist das aber auch
zu empfehlen!
- Stefan - 11/2023
 Das Hamburger Label „Bureau B" ist schon seit Jahren eine
Top-Adresse für Wiederveröffentlichungen älterer deutscher Titel von
elektronischer Musik bis hin zu Alben aus der Anfangszeit der NDW. Der
mittlerweile doch sehr umfangreiche Katalog umfasst auch eine Menge
Stoff, der für Freunde von sog. Krautrock und Sounds aus der „Berliner
Schule“ vieles bereithält, was längst eine Neuauflage verdient hatte
oder zu seiner Entstehungszeit durch den Rost fiel und jetzt eine
Wiederentdeckung erfährt.
Das Hamburger Label „Bureau B" ist schon seit Jahren eine
Top-Adresse für Wiederveröffentlichungen älterer deutscher Titel von
elektronischer Musik bis hin zu Alben aus der Anfangszeit der NDW. Der
mittlerweile doch sehr umfangreiche Katalog umfasst auch eine Menge
Stoff, der für Freunde von sog. Krautrock und Sounds aus der „Berliner
Schule“ vieles bereithält, was längst eine Neuauflage verdient hatte
oder zu seiner Entstehungszeit durch den Rost fiel und jetzt eine
Wiederentdeckung erfährt.
Rolf Trostel zählte, das lässt sich angesichts seiner Musik nicht
leugnen, zu den stark von TANGERINE DREAM beeinflussten Elektronikern,
wobei hier besonders die zweite Hälfte der Siebziger prägend gewesen
sein dürfte. Auch wenn die Vorbilder schon deutlich zu erkennen sind,
wäre der Begriff Epigone nicht angebracht – zu abwertend und auch nicht
fair, denn hier wird nicht einfach stumpf kopiert und lediglich eine
erfolgreiche Formel bedient. Die aktivste Zeit von Trostel fällt in die
frühen Achtziger, damals erschienen binnen weniger Jahre gleich drei
Alben (die alle über Bureau B auf CD und Vinyl Mitte der 2010er Jahre
wiederveröffentlicht worden sind).
Müsste man den Stil der vorliegenden Scheibe von 1982 beschreiben,
würde die Mischung aus analogen und digitalen Sounds, mit denen „Two
Faces“ aufgenommen wurde, ihrerseits einen Mix aus Kühle und Wärme
darstellen. Zielstrebig und mechanisch auf der einen Seite, aber auch
mit melodischen Elementen verziert, die dem Ganzen einen nachdenklichen Touch geben. Hier mag vielleicht auch der
Hang zu religiösen Themen, die in anderen Werken von Rolf Trostel
erscheinen, eine musikalische Rolle gespielt haben. Auch der Wechsel
aus relativ kurzen Stücken und den beiden Tracks, die teils deutlich
jenseits der Zehn-Minuten-Grenze liegen, sorgt für Abwechslung, ohne
„Two Faces“ dabei aber stilistisch in Einzelteile zerfallen zu lassen.
nachdenklichen Touch geben. Hier mag vielleicht auch der
Hang zu religiösen Themen, die in anderen Werken von Rolf Trostel
erscheinen, eine musikalische Rolle gespielt haben. Auch der Wechsel
aus relativ kurzen Stücken und den beiden Tracks, die teils deutlich
jenseits der Zehn-Minuten-Grenze liegen, sorgt für Abwechslung, ohne
„Two Faces“ dabei aber stilistisch in Einzelteile zerfallen zu lassen.
Am stärksten ist das komplett in Eigenregie entstandene Album immer
dann, wenn der Sequenzer-Rhythmus die Führung übernimmt, sozusagen die
Richtung vorgibt und die begleitenden Melodien dem folgen. Es mag
nichts Bahnbrechendes oder besonders Originelles sein, was dabei
entstand (dafür sind die Ideengeber wohl doch zu präsent), aber in
seinen besten Passagen hat „Two Faces“ für den Liebhaber klassischer
Elektronik-Sounds aus jenen Tagen genügend Überzeugendes zu bieten, um
nicht nur auf der Nostalgie-Schiene zu funktionieren. Das kann man auch
heute noch mit Gewinn hören, ohne die Musik auf ihren Retro-Charme zu
reduzieren. Der Titeltrack etwa, zugleich der längste der Platte, ist
mit seinen Atmosphäre- und Tempowechseln ein gelungen arrangiertes
Stück, das sich den Status eines Geheimtipps für
Frühachtziger-Elektronik-Fans redlich verdient hat. Hörenswert!
- Stefan - 11/2023

 Ein rätselhaftes Album: Aus dem CD-Booklet der
kalifornischen Indie-Band MONKS OF DOOM blickt einem der „Kini“ (König
Ludwig II. von Bayern) entgegen, auch wenn sich der tiefere Sinn seiner
grafischen Präsenz für den Betrachter nicht so recht erschließen mag.
Auch das (mutmaßliche) Spaß-Latein des im Inlay abgedruckten Spruchs
„Illegitimi non carborundum“ ist verwirrend: Nach diesbezüglicher
Recherche soll das auf Insidergags aus der US-Collegeszene zurückgehen,
wobei die Frage wäre, welche Illegitimen denn hier bitteschön nicht
„verkohlt“ werden sollten.
Ein rätselhaftes Album: Aus dem CD-Booklet der
kalifornischen Indie-Band MONKS OF DOOM blickt einem der „Kini“ (König
Ludwig II. von Bayern) entgegen, auch wenn sich der tiefere Sinn seiner
grafischen Präsenz für den Betrachter nicht so recht erschließen mag.
Auch das (mutmaßliche) Spaß-Latein des im Inlay abgedruckten Spruchs
„Illegitimi non carborundum“ ist verwirrend: Nach diesbezüglicher
Recherche soll das auf Insidergags aus der US-Collegeszene zurückgehen,
wobei die Frage wäre, welche Illegitimen denn hier bitteschön nicht
„verkohlt“ werden sollten.
Wie dem auch sei: Die MONKS OF DOOM entstanden Mitte der Achtziger im Umfeld der Band CAMPER VAN BEETHOVEN und sie sind bis in die späten 2010er Jahre mit Veröffentlichungen aktiv gewesen, wenn auch mit sehr langen Pausen zwischen den Alben. Ihr Alternative-Sound entzieht sich schnellen Klassifizierungen, da ein Album wie „Meridian“ munter alle möglichen Stilrichtungen vermengt und ein echtes Sammelsurium darstellt. Mal ruhig und langsam, dann wieder abgedreht fast jazzig-progressiv, da ist also für viele Geschmäcker was dabei. Anders formuliert: ein richtiges Durcheinander.
Laut Discogs kam die Scheibe damals sogar über einen deutschen Vertrieb auch hierzulande auf den Markt, wobei unsere Variante mit einem Track weniger erschien (als „Interlude“ oder „Untitled“ geführt, ist auf dem Backcover der US-Ausgabe zwar auch nicht gelistet, aber auf der CD enthalten). Musikalisch machten es sich die MONKS OF DOOM wie erwähnt zwischen diversen Stühlen bequem und wenn es auch in einem der Songs optimistisch heißt „The door to success is always open“, sah die Realität anders aus. Das US-Label soll damals eine kurzlebige Angelegenheit gewesen sein, über 1992 hinaus sind keine weiteren Veröffentlichungen belegt. Mehr als eine Art Geheimtipp-Status konnte „Meridian“ daher bis heute nicht erreichen.

Der Sound der Monks ist von zahlreichen Einflüssen geprägt und entstand in einem ausgedehnten Jam-Session-Prozess, was man der Platte auch anhört. Wie man das labelseitig dann vermarkten soll, ist eine andere Frage. Die Band hat zumindest in den Staaten heute noch ihre Fans, die wohl auch schon ältere Semester und daher einfach mitgegangen sind. Was mich an „Meridian“ seit dem ersten Hören fasziniert, ist die Tatsache, dass die Musik auf der einen Seite manchmal sogar etwas anstrengend ist, andererseits aber einen interessanten Sog entwickelt, der sich kaum auf herkömmliche Weise erklären lässt. Denn eine bekannte Hit-Single, die das Album mitzieht, fehlt hier, einen seinerzeit aktuellen Trend bedient das Album auch nicht.
Die Bezeichnung „Alternative“ hätte nach damaligem Verständnis mehr in die Grunge-Richtung gewiesen, damit hatten die MONKS OF DOOM jedoch nichts gemein. Eine Verbindung zum Seattle-Sound gibt es lediglich, was die durchgehend spürbare melancholische Haltung angeht: Die Musik auf „Meridian“ ist kein Gute-Laune-Rock mit „knackigen Riffs“, sondern stets etwas neben der Spur: schräg, eigenwillig, mit ungewöhnlichen Ideen. Das trifft beim Hörer möglicherweise zunächst auf eine ganz ungeeignete Stimmungslage, das muss man sich eben erarbeiten. „Meridian“ ist nicht wirklich gefallsüchtig, aber wenn die Musik einmal Wurzeln geschlagen hat, dann vermag sie zu bleiben. Kommerziell hat die CD wenig gerissen, aber dafür ist sie immerhin gebraucht zu durchaus normalen Preisen auf einschlägigen Plattformen noch zu bekommen.
- Stefan - 11/2023
 In einem Zitat des Philosophen und Vorsokratikers
Parmenides von Elea im Booklet der LP von „Zeit“ (fehlt bei meiner CD
aus den Neunzigern) wird der Rahmen dieses außergewöhnlichen Albums
entworfen. Grob gesagt soll die Zeit nur im Kopf des Menschen, im
Denken existieren, darüber hinaus jedoch geschehe nichts, so
Parmenides: „Es gibt nur Starre, Sein, Denken und sonst NICHTS“. Unter
dieser Prämisse kann das Album als Versuch begriffen werden, diese
Welt- und Existenzdeutung in eine musikalische Form zu überführen. Das
Resultat gilt auch unter toleranten TD-Anhängern als bemerkenswert
ambitioniert und zugleich umstritten.
In einem Zitat des Philosophen und Vorsokratikers
Parmenides von Elea im Booklet der LP von „Zeit“ (fehlt bei meiner CD
aus den Neunzigern) wird der Rahmen dieses außergewöhnlichen Albums
entworfen. Grob gesagt soll die Zeit nur im Kopf des Menschen, im
Denken existieren, darüber hinaus jedoch geschehe nichts, so
Parmenides: „Es gibt nur Starre, Sein, Denken und sonst NICHTS“. Unter
dieser Prämisse kann das Album als Versuch begriffen werden, diese
Welt- und Existenzdeutung in eine musikalische Form zu überführen. Das
Resultat gilt auch unter toleranten TD-Anhängern als bemerkenswert
ambitioniert und zugleich umstritten.
Die einen schwelgen in der Langsamkeit und Statik, die förmlich
zelebriert wird, die anderen finden wiederum so gar keinen Zugang, es
fallen Begriffe wie „einschläfernd“. In ausgedehnten Stücken, die sich
zwischen 17 und 20 Minuten bewegen, wabert ein Sound, der traditionelle
Strukturen aufkündigt. Die vom Sequenzer getriebene und strukturgebende
Rhythmik späterer TD-Alben greift hier überhaupt nicht. Die Basis von
„Zeit“ besteht einerseits aus Cello-Klängen, die von mehreren
Gastmusikern eingespielt wurden, dazu treten Synthesizer-Elemente, bei
denen auch Florian Fricke (POPOL VUH) mitwirkte. Stilistisch ist das
Klaus Schulzes „Cyborg“ nicht unähnlich, wirkt aber bisweilen noch
monolithischer und auch dunkler in seinen Klangfarben.
 „Nichts wird alt und nichts neu, nichts wird
hinweggenommen und nichts kommt hinzu“ schreibt Parmenides und ob er da
nun Recht hat, ist gar nicht so entscheidend. Dieses philosophische
Postulat kann für sich stehen und die geistige Grundlage für das
vorliegende Werk sein. „Zeit“ bewegt sich allein im Hier und Jetzt, als
wäre man in einen der reinen Existenz verpflichteten Klangkosmos
eingetaucht. TANGERINE DREAM gingen danach schon bald in eine andere
musikalische Richtung und blieben dennoch mit ihrer musikalischen
Handschrift erkennbar. Bereits zwei Jahre später entstand das Album
„Phaedra“ und brachte mit neuem Label (Virgin) auch kommerziell den
internationalen Durchbruch, was aber bei einigen Hörern auf Widerstand
stieß. Ich finde gerade die Quelle nicht mehr, kann mich aber an ein
Zitat erinnern, in dem ein erboster Kritiker der Band vorwarf, mit
„Phaedra“ angeblich im Sumpf des Easy Listening (!) angekommen zu sein.
Eine abenteuerliche Einschätzung, denn das 1974er Erfolgsalbum ist ja
nun bestimmt kein seichter Bubblegum-Pop, aber womöglich war das
Arbeiten mit Rhythmik und nachvollziehbareren Strukturen für manche
Zeitgenossen schon musikalischer Verrat, wer weiß.
„Nichts wird alt und nichts neu, nichts wird
hinweggenommen und nichts kommt hinzu“ schreibt Parmenides und ob er da
nun Recht hat, ist gar nicht so entscheidend. Dieses philosophische
Postulat kann für sich stehen und die geistige Grundlage für das
vorliegende Werk sein. „Zeit“ bewegt sich allein im Hier und Jetzt, als
wäre man in einen der reinen Existenz verpflichteten Klangkosmos
eingetaucht. TANGERINE DREAM gingen danach schon bald in eine andere
musikalische Richtung und blieben dennoch mit ihrer musikalischen
Handschrift erkennbar. Bereits zwei Jahre später entstand das Album
„Phaedra“ und brachte mit neuem Label (Virgin) auch kommerziell den
internationalen Durchbruch, was aber bei einigen Hörern auf Widerstand
stieß. Ich finde gerade die Quelle nicht mehr, kann mich aber an ein
Zitat erinnern, in dem ein erboster Kritiker der Band vorwarf, mit
„Phaedra“ angeblich im Sumpf des Easy Listening (!) angekommen zu sein.
Eine abenteuerliche Einschätzung, denn das 1974er Erfolgsalbum ist ja
nun bestimmt kein seichter Bubblegum-Pop, aber womöglich war das
Arbeiten mit Rhythmik und nachvollziehbareren Strukturen für manche
Zeitgenossen schon musikalischer Verrat, wer weiß.
Für Neueinsteiger, die mit „Zeit“ zunächst gar nichts anfangen können,
mag der britische Musiker und Produzent Steven Wilson (PORCUPINE TREE)
ein Orientierungspunkt sein. Er soll vor Jahren zu Protokoll gegeben
haben, dass ihm die Platte anfangs nicht gefiel, bis er jedoch
schrittweise mehr und mehr Zugang fand und sie heute als sein
persönliches Lieblingsalbum bezeichnet. Wer sich das komplette Package
geben möchte, kann nach der Doppel-CD Ausschau halten, die auf der
zweiten Scheibe einen vor exakt 51 Jahren im Sendesaal des Kölner
Rundfunkhauses entstandenen Live-Mitschnitt enthält, der mit zwei
Tracks und insgesamt 78 Minuten die CD-Kapazität ausreizt. Die
Faszination, die „Zeit“ für fortgeschrittene TD-Anhänger ausstrahlt,
ist für andere hartes Brot und kann Abwehrreaktionen auslösen, doch
ähnlich wie „Cyborg“ von Klaus Schulze ist auch dieses Album für mich
ein entschleunigender Begleiter für kommende kalte Winternächte.
- Stefan - 11/2023