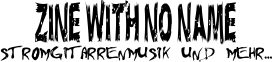
Die Wertung gleicht der Einfachheit halber wieder einmal der bei den Movies, zur Orientierung vorangestellt abermals der dazugehörige sternige Bewertungsschlüssel...
* - miserabel
** - akzeptabel
*** - gut!
**** - sehr gut!!
***** - außerordentlich gut!!!
****** - absolut großartig, fantastisch, begeisternd!!!!!!!
"Die triftigste Frage,
die über ein Buch gestellt werden kann,
ist die,
ob es jemals einer menschlichen Seele geholfen hat."
- Walt Whitman -
Ronald M. Hahn, Volker Jansen - "Die 100 Besten Kultfilme"
Dieter Krusche - "Reclams Filmführer"
Martin Büsser - "Popmusik"
Wolfgang Rumpf - "Stairway To Heaven - Kleine Geschichte
der Popmusik von Rock´n´Roll bis Techno"
Nick Hornby - "31 Songs"
Dean R. Koontz - "Das Versteck"
Joolz Denby - "Im Herzen Die Dunkelheit"
Wladimir Kaminer - "Mein Deutsches Dschungelbuch"
Stephen King - "Dreamcatcher"
Margaret Atwood - "Oryx Und Crake"
Henning Mankell - "Der Chronist Der Winde"
Diverse Autoren - "40 Jahre Fußball-Bundesliga"
Nick Hornby - "Fever Pitch"
Dies Sachbuch entpuppt sich bei näherer Betrachtung als exakt den vom
Titel evozierten Vorstellungen entsprechend; also brauchte ich im Grunde kaum
etwas dazu zu sagen. Sachlich, aber zugleich packend, anschaulich und durchaus
nicht unkritisch werden Filme vorgestellt, welche, jeder auf seine ganz spezielle
Art, unsterblich wurden und von einem eingeschworenen Fankreis dauerhafte, kultische
Verehrung erfahren. Aufzählungen dürften überflüssig sein.
Viele der aufgeführten Werke erwartet man in so einem Buch vorzufinden,
einige sind eher überraschend beziehungsweise bislang unbekannt und einige
wenige wie "Rattennest" oder "Deep Throat" hätte man vielleicht lieber
durch andere ersetzt gesehen. Zumal manch wirklich essentielle und ausgewiesen
beständige, ja, für eine solche Zusammenstellung geradezu zwingende
Produktionen fehlen. Nicht weiter verwunderlich, denn selbst die auf 100 begrenzte
Auswahl bringt es bereits auf schlappe 680, selbstredend auch ordentlich bebilderte
Seiten. Es dürfte da sowieso ein jeder seine eigenen Favoriten haben. Durch
die Lektüre angeregt fing ich spaßeshalber an, Filme, die es ob ihres
Status genauso berechtigt in eine solche Publikation hätten schaffen können,
so, wie sie mir gerade in den Sinn kamen, über mehrere Tage hinweg sukzessive
auf einen Zettel zu kritzeln. Es wurden schätzungsweise mehr als siebzig...
Beispiele: Der Pate, Alien, Der Clou, Omen, The Crying Game, Nur Samstag
Nacht, Forrest Gump, Der Mit Dem Wolf Tanzt, China Town, The Wild One, Léon,
Die Klapperschlange und und und... - ha!, vielleicht sollte ich versuchen,
selbst mal so ein Buch zusammen zu schustern...!
Nur gut, daß ich meine Grenzen kenne...
...oder "Night On Earth", "Harold und Maude", "Fight Club", "Night Of The
Living Dead", die "Rosaroter Panther"-Filme mit Peter Sellers, die "Planet der
Affen"-Filme aus den 60ern und 70ern, "Akira", "Bis das Blut gefriert" (dämlicher
deutscher Titel von "The Haunting", 1963; einer der beängstigendsten Filme,
die ich kenne. Das Remake Ende der 90er unter dem Titel "Das Geisterschloss"
konnte da nicht mithalten) ...
- Martin -
So glänzend wie geschrieben wurde das Material auch recherchiert. Dies
zeigt sich indikativ alleine schon an den in ein paar Fällen vorkommenden
Anmerkungen zu schlampig ausgeführten Synchronisationen.
Beide Autoren zeichnen ebenfalls für fette Lexika über Science Fiction-,
Fantasy- und Horror-Filme verantwortlich, welche allerdings, neben den üblichen
personellen Daten und einem ob der großen Anzahl im Gesamtüberblick
notwendigerweise nur ganz kurz umrissenen Plot, und im Gegensatz zu diesem hier
vorgestellten 1998 erschienenen Buch, für den durchschnittlichen, laienhaften
Interessenten eigentlich keine weiterführenden gehaltvollen Ausführungen
bieten.
Aber das hier ... das war halt mal wieder so ein Schmöker gewesen, der
einen für mindestens drei Tage fieberhaften Lesegenußes nicht mehr
losließ...!
*****(*)
Als Nachtrag zum Thema zwei unbedeutende Erinnerungsfetzen:
>>> Der bedeutendste, größte und Prototyp aller sogenannter Kultfilme dürfte ohne Zweifel die Rocky Horror Picture Show sein. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ein paar Freunde und ich Anfang der 90er deren Mythos auf den Grund zu gehen trachteten und sie uns gemeinsam im Fernsehen ansahen - und brauche wohl nicht eigens zu betonen, daß wir alle den Streifen so richtig schön scheiße fanden... Heute sähe ich das bestimmt etwas lässiger, humorvoller, differenzierter, damals wurde ich von dem schrillen, grellen Musical verwirrt und ratlos zurück gelassen. Wahrscheinlich versteht man die anhaltende Faszination der Rocky Horror Picture Show am ehesten, wenn man sich eine Vorstellung im Kino ansieht und der rituelle Charakter durch die anderen Besucher, die bei jeder Szene mitgehenden, sich einbringenden, teilnehmenden eingefleischten Fans veranschaulicht wird.
Die Rocky Horror Picture Show find' ich ja nach wie vor so richtig schön
scheiße. Mir hat sich bis heute nicht erschlossen, was daran "Kult" sein
soll. Ist die Fernsehübertragung des Mainzer Karnevals Kult? Eben. Völlig
daneben sind zudem Interpretationen, die in dem Film bzw. dem Musical etwas
"Rebellisches" oder "Schräges" sehen wollen. Dann müßte man
"American Pie I - X" auch Systemkritik attestieren, denn das ist die gleiche
Ebene, nur halt 20 Jahre später.
Aber, Heiko, hast du von notorischen Spaßbremsen wie mir einen
anderen Kommentar erwartet?
- Martin -
>>> Dann fällt mir noch der Film Westworld ein, irgendwie
ebenfalls ein kleiner Kultfilm. Ich war vielleicht neun, zehn, höchstens
elf Jahre alt und setzte durch, ihn mir ansehen zu dürfen. Ein grober Fehler.
An diesem Abend lag ich schlotternd unter der über den Kopf gezogenen Decke
im Bett und getraute mich kaum, die Nachttisch-Lampe auszuschalten. Jeden Moment
rechnete ich damit, daß ein sich selbständig gemachter, emotionsloser
Cowboy-Android, aussehend wie Yul Brynner, der schon seit längerem meine
Fährte in unzweideutiger Absicht aufgenommen hatte, mit gezogenem Colt
in mein Zimmer eindringen würde...
Noch tagelang schien mich der Wecker den ich damals hatte, auf dessen Ziffernblatt
ein laufender Cowboy aufgemalt war, dessen schießeisentragende Hand wiederum
mit der Mechanik verbunden auf und ab wippend Geballere simulierte, verhöhnen
zu wollen....
Nun sollte man doch annehmen, ein solches traumatisierendes Kindheitserlebnis
würde einen ein für alle Mal vom Wunsch, sich von Horror-Geschichten
ängstigen zu lassen kurieren, oder?!?
Hier ließ der pädagogische Wert dennoch zu wünschen übrig.
Yo, an "Westworld" kann ich mich auch noch erinnern. Ich hab' ihn zu einer
Zeit gesehen, als der elterliche Fernsehapparat nicht mehr als drei Programme
zur Auswahl hatte, Mitte der 80er dürfte das gewesen sein. Der Film wurde
1973 gedreht. Den Cowboy-Androiden spielte übrigens wirklich Yul Brynner
und Regie und Drehbuch stammten von Michael "Jurrasic Park" Crichton. Erst jetzt,
wo Heiko den Film erwähnte, fiel mir endlich ein, an wen mich der "Terminator"
erinnert hat, nämlich an den Revolverhelden aus "Westworld".
- Martin -
Etwa 1000 Filme auf rund 760 Seiten werden besprochen in diesem im Jahre 2000
erschienenen, wirklich beeindruckenden Wälzer. Nicht unbedingt die besten,
sondern vielmehr, wie der Autor im Vorwort betont, eine Auswahl der wichtigsten
Filme werden für Konsumenten vorgestellt, die von dieser künstlerischen
Ausdrucksform nicht allein Unterhaltung und Zeitvertreib erwarten. Auch wenn
sich auf dem Einband großformatige Bilder aus Titanic und Lola
Rennt lockend breitmachen, erlangt Aktualität oder kommerzieller Erfolg
für die Zusammenstellung keinerlei Bedeutung, und es werden desweiteren
zeitlich alle Epochen gleich berechtigt behandelt, so gibt es demzufolge viele
Einträge aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, auch
aus der Stummfilmzeit. Eine hübsche Ansammlung von Streifen kommt da zusammen,
von denen ich zuvor noch nie etwas gehört hatte und von denen mich viele,
zumindest anfangs, allenfalls am Rande interessierten. So las ich denn selektiv
zuerst die geläufigen Sachen, eine zwangsläufige Vorgehensweise, wird
man von der gebotenen Fülle doch erst einmal erschlagen. Jedoch drang ich
beständig weiter in die faszinierenden Tiefen des Schriftwerks vor und
erschloß mir mittlerweile über drei Viertel des Filmführers.
Das war, wie oben angedeutet, nicht abzusehen und beabsichtigt, wollte ich doch
ursprünglich mich nicht so lange damit aufhalten und vorrangig professionelle
Meinungen und Wertungen zu Filmen lesen, die ich meinerseits schon begutachten
konnte. Selbstverständlich zähle ich mich weniger zu der engstirnigen
Variante der menschlichen Spezies, welche nur jenes fixiert, das sie sowieso
bereits kennt oder das möglichst reibungslos in ihr bisheriges Raster paßt.
So war es etwa durchaus erhellend, mal von fachmännischer Seite erläutert
zu bekommen, was es, um mal einen Namen heraus zu greifen, mit dem schwedischen
Kunstfilmer Ingmar Bergman so auf sich hat. Bereits der alleine ist, sicher
nicht unberechtigt, mit schätzungsweise mehr als einem Dutzend Werken am
Start. Die Zeiten, als ich der pubertären wie damals unerschütterlichen
Auffassung war, das Selbstquälerischste was man tun könne, sei, sich
einen französischen Film anzusehen, und das Höchste der cinematographischen
Kunstfertigkeit wäre zweifelsohne Abenteuer- und SF-Gedöns perfekten
hollywood'schen Unterhaltungszuschnitts wie Jäger Des Verlorenen Schatzes
oder Star Wars, scheinen sich mit zunehmendem Horizont nun doch so langsam
zu verflüchtigen, abgelebt zu haben. Bei einer Neuaufstellung der Orientierung
bieten Standardwerke wie dieser Filmführer wertvolle Hilfestellungen und
Anregungen.
Auch wenn ich anhand des Beispiels eines anderen anerkannten Meisterregisseurs,
des Spaniers Louis Bunuel, zugegebenermaßen nach wie vor keineswegs in
jedem Fall Zugang finde. Dank Krusches kompetenter Erläuterungen solcher
Streifen wie Belle De Jour oder Dieses Obskure Objekt Der Begierde
des genannten Regisseurs, ist es zwar ohne weiteres möglich, diese intellektuell
zu goutieren, trotzdem jedoch empfand ich sie - sorry - nicht wenig langatmig...
Die Aussage, daß Dieses Obskure Objekt Der Begierde die Absurdität
unserer Realität zeige, erweist sich als ungenügend, um ein zumindest
für mich überwiegend nichtssagendes Sujet entscheidend aufzuwerten.
Nun, ich möchte aus dem Widerspruch zwischen Kommentierung der umweltbedingten
Realität und beabsichtigter Absenz derselben, zwischen botschaftummanteltem
Anspruch und simplem Entertainment hier keine längere Diskussion entfachen,
es dürfte mir sowieso schwerlich in einigen wenigen Sätzen gelingen,
diesen permanenten Spannungsbogen im Bereich der Kreativität zu entkrampfen
und zu einer Versöhnung zu bringen. Am vorteilhaftesten in der Kunst ist
sowieso, wenn diese Trennlinie - beim Schaffenden, den Rezipienten, dem Werk
selbst - verwischt und beides zugleich erreicht wird.
Als Fazit kann man den Filmführer etwaigen Interessenten uneingeschränkt
empfehlen. Krusche gibt die Plots sehr anschaulich wieder und seine messerscharfen,
wirklich klugen und tiefschürfenden Analysen sind von massiver Anerkennung
abverlangender Brillanz.
******
Dieses im Jahre 2000 erschienene kleine Büchlein setzt sich, der Titel
mag es andeuten, mit der Entwicklung der Popmusik, von ihren Anfängen bis
in die Gegenwart der Jahrtausendwende, auseinander. Dabei wirft jedes Kapitel
ein Schlaglicht auf all ihre verschiedenen Spielarten wie Rock'n'Roll, Beat,
Psychedelic, Hippie-Bewegung, Funk, Politrock, Glam, Disco, Punk, New Wave,
Hip Hop, Grunge, das DJ und Techno-Kontinuum, Post-Rock uvw., wobei für
mich gerade Themen, zu denen mir bislang weitgehend der Zugang fehlt, am reizvollsten
erschienen. Die Herangehensweise bleibt bewußt knapp und skizzenhaft gehalten,
so daß sich der Umfang in 90 Seiten bereits erschöpft.
Besonderes Augenmerk legt Büsser (Mitherausgeber der Zeitschrift Testcard
- und schrieb er nicht auch mal für's Zap?) (stimmt! - Martin)
auf die gesellschaftliche Relevanz und Dissidenz einer jeden künstlerischen
Äußerung. Für meinen Geschmack bleibt es für manche Stilarten
eher als für andere unangebracht, daraus ein übertriebenes Politikum
zu konstruieren oder ein solches einzufordern. Da sind wir bei einer kleinen
Problematik und bei einer entscheidenden Divergenz angelangt. Denn Büsser
neigt dazu, dies unentwegt zu tun. Mit politischem Bewußtsein aufgeladen
und offensichtlich tendenziell aus der linken Ecke kommend, wittert er sofort
Stillstand der Entwicklung, kindliche Banalität und einen Verwendungszweck,
den früher die Kommunisten auf die Religion bezogen mit Opium für's
Volk umschrieben, wenn ein Kunstwerk es wagen sollte, sich zu sehr an etablierten
Formen zu orientieren oder seine Daseinsbegründung größtenteils
in sich selbst zu finden. Dies führt zwangsläufig in tendenziöse
Abschnitte wie dem nachfolgend zitierten:
"Für Idealisten war spätestens um 1974 entschieden, daß die
Popmusik ihren rebellischen Geist verloren hatte und zum bloßen Geschäft
wurde. An den Stars jener Zeit, von Genesis bis Pink Floyd, von Deep Purple
bis Fleetwood Mac, trat die Kommerzialität offen zutage. Diese Rock-Dinosaurier
verband weder etwas Politisches noch Rebellisches, viel mehr waren ihre inszenierten
Live-Spektakel perfektes Illusions-Theater, sie standen vor allem für aufwändig
produzierte Konzeptalben. Die Plattencover von Bands wie Yes, Emerson, Lake
& Palmer und Led Zeppelin waren im märchenhaften Fantasy-Stil gehalten,
ihre Songs erzählten von Rittern, Feen und Elfen. ... Die Arrangements
wurden aufwändiger, doch jeglicher Bezug zur Gesellschaft verschwand. ...
Bombast und Virtuosität sind hier zum Selbstzweck geworden."
Mal ganz von dem Umstand abgesehen, daß die genannten Bands sicherlich
alles andere als ausschließlich von Rittern, Feen und Elfen erzählten,
halte ich es einfach für problematisch, Kunst an irgendwelchen Dogmen festmachen
zu wollen und, sollte sie die erforderlichen Merkmale nicht aufweisen, zu verwerfen.
Wer behauptet denn, daß Musik unbedingt politisch oder rebellisch sein
müsse?!? Natürlich hat sie immer einen gesellschaftlichen genauso
wie einen individuellen Bezug, aber ihre subversive, revolutionäre Kraft
ist doch nur ein Wert unter vielen anderen. Musik kann große gesellschaftliche
Umwälzungen, wie beispielweise in den Sechzigern, begleiten, wiederspiegeln,
ja sogar vorantreiben. Aber Popmusik in ihrer Gesamtheit hat sich inzwischen,
wie Büsser selbst feststellt, längst saturiert, ist Teil des Establishments
geworden, ist fest in der Hand der Medien und Unterhatungsindustrie. Wenn eine
potentiell rebellische Jugendbewegung, so wie vor einem Jahrzehnt der Grunge,
aus den versifften Übungskellern und verrauchten kleinen Clubs, aus der
individuellen Subkultur ans hochglänzende mediale Licht der breiteren Öffentlichkeit
gelangt, wird sie zwangsläufig von den Konzernen umgehend auf- und ausverkauft.
Ein bezeichnendes aktuelles Beispiel sind die Rock'n'Roller von Jet, deren fetziger
erster Single-Hit sogleich gewinnträchtig für einen Werbespot des
Telekommunikationsriesen Vodafone verbraten wurde. Sieht darin heute noch einer
ein Problem? Anbiederung statt Rebellion: Popmusik ist inzwischen nicht nur
ein großes Geschäft, sondern ein allgegenwärtiger Teil des Alltags.
Außerdem scheinen alle möglichen Extremitäten in Wort, Geste
und Ton mittlerweile ohnehin exploriert und ziemlich ausgereizt, alle Provokationen
schon einmal dagewesen und alle Tabus gebrochen. Wo soll sich da das Rebellentum
denn noch festbeißen, außer vielleicht, wie jüngst im Punk-Rock-Stil,
an der Wade der amerikanischen Bush-Administration, der dankbarsten und fettesten
aller Zielscheiben? Wenn irgendein besorgter, ein politisches Amt bekleidender
Spießbürger den Schock-Rocker Marylin Manson (wieviel von dessen
Auftreten kommerzielles Kalkül ist, bleibt eine andere Frage) für
den Untergang der westlichen Zivilisation verantwortlich machen und als willkommenen
Sündenbock für das Massaker von Littleton brandmarken möchte,
bildet das heutzutage eher die Ausnahme.
Selbstredend ist es wichtig, daß Kunst den Menschen sowohl intellektuell
stimulieren und wenn es angebracht erscheint auch irritieren, herausfordern,
erschüttern, provozieren darf. Das möchte sicher niemand in Abrede
stellen.
Aber was gäbe es denn, weiterhin gefragt, andererseits gegen "perfektes
Illusions-Theater" einzuwenden? Darf man sich keinerlei Auszeit von einer
zuweilen drögen bzw. für sich genommen bereits ausreichend fordernden
Alltagsrealität gönnen? Was diente denn besser der Erholung und Erbauung?
Man könnte gerade meinen, für den aufgeklärten, denkenden Homo
Sapiens dürften zu diesem Zwecke allenfalls noch die 20:00 Uhr-Nachrichten
herhalten. Der Eintritt ins Abenteuerland kostet nun mal den Verstand, selbst
wenn dies manchem allzu intellektuell orientierten Menschen zwangsläufig
auch noch so suspekt erscheinen mag. Es ist in meinen Augen eine Unsitte solcher
Leute, daß sie meinen, Musik, welche keinen plakativ-offensichtlichen
Konfliktstoff stilistischer oder inhaltlicher Natur bietet, nicht anders als
abwertend behandeln zu können.
Letztlich unabhängig davon, ob man mit rotzigen, kämpferischen Hymnen
soziale Mißstände und politische Verfehlungen angreift, oder sich
identitätsverloren auf eine introvertierte Traumreise begibt, sich nach
außen oder innen wendet, sich in eher konventionelle oder experimentelle
Strukturen begibt, hat alles seine Berechtigung, ist jedwede Form der Äußerung,
Rezeption, Kommunikation als gleich berechtigt anzusehen - sofern sie andere
nicht beeinträchtigt und das eigene Dasein bereichert. Solange man liebt,
was man tut.
Okay, genug damit. Meine Position dürfte wohl deutlich genug geworden sein.
Üblicherweise kursieren solche Fragestellungen ja sowieso eher an der Peripherie
meines diskursiven Bewußtseins.
Ich kann die Denk- und Sichtweise von Leuten wie Martin Büsser absolut
nachvollziehen und respektieren. Wie man aber sieht, pflege ich mich dann doch
unverhältnismäßig daran zu reiben...
Selbst wenn mich jede andere Art der Konzeption ebenso verstandes- wie gefühlsmäßig
interessiert, ist Musik für mich, vor allem anderen, erst einmal dieses:
einerseits eine Art universeller Kommunikation, ein unmittelbarer Austausch
von Seele zu Seele, und zugleich ein Tor zu einer glückstrahlenden Innerlichkeit.
Da es sich anbietet, lasse ich mir einmal mehr von good ol' Hermann Hesse eine
abschließende Bekräftigung ausstellen und meine Abhandlung abrunden...
"Zwischen Marx und mir ist, abgesehen von den viel größeren Dimensionen
von Marx, der Unterschied der: Marx will die Welt ändern, ich aber den
einzelnen Menschen. Er wendet sich an Massen, ich an Individuen. Je weniger
ich an unsere Zeit glauben kann, desto weniger stelle ich diesem Verfall die
Revolution entgegen, und desto mehr glaube ich an die Magie der Liebe."
Na gut, einen hab' ich noch...
Durch die demonstrativ unpolitische und drogendurchdrungene Techno-Bewegung
wurde Büsser überraschenderweise zu keiner seiner - wirklich nur vereinzelten!
- wegwerfenden Äußerungen provoziert.
Daß sich die Techno-Raver von ihrer geistigen Intention und ihrem Umgang
mit dem Medium Musik trotz aller äußerlichen Divergenzen von jemandem
wie mir kaum unterscheiden, der sich auf die Couch setzt bzw. ins Bett legt,
die Augen schließt, sowie alle anderen Sinne und den nun überflüssigen
Organismus abschaltet, und sich wassergleich dahinfließend in der Veränderung
von Perspektive und Bewußtsein mit den Klängen (Texten) verwoben
in eine völlig andere, nicht minder reale, sondern viel mehr noch wesentlich
lebendigere und unbegrenzter dimensionierte Welt und Daseinsform entschwinden
läßt, wurde mir umgehend durch Beobachtung und Einfühlung klar.
Ein in Büssers Buch zitierter Typ namens Peter Huber lieferte mit einer
wirklich coolen Formulierung die Bestätigung...
"Tanzen:
Warum ist Techno / House in erster Linie Tanzmusik?
Seit es den Menschen gibt,
sucht er in Tanz und Rhythmus
Verbindung zu Kräften und Zuständen,
die ihn aus seiner bestehenden Beschränkung
befreien
und ihm den Alltag erträglicher machen.
Einfacher ausgedrückt:
Mit viel guter Laune und dem Groove unterm Arsch
läßt sich der ganz normale Wahnsinn
besser ertragen."
Wertung des ansonsten kenntnisreich und gut geschriebenen Buches im ganzen, grob über den Daumen gepeilt: ***(*)
Wie Heiko sich richtig erinnert hat, schrieb Martin Büsser Anfang der
90er Jahre für's Hardcore-Fanzine ZAP, das man, wenn man damals, wie wir,
ein Fanzine herausgab, einfach kennen mußte. Zuerst widmete sich Martin
Büsser der wissenschaftlichen Untersuchung von Punk und Hardcore, später,
in seinen Büchern im Ventil-Verlag, an dem er irgendwie beteiligt ist,
Phänomenen der Pop-Kultur allgemein. Daraus erklärt sich die Herangehensweise
von "Popmusik", musikalische Stilrichtungen auf ihre gesellschaftspolitische
Relevanz hin abzuklopfen. Wen das nicht stört, dem seien zwei weitere Bücher
von Martin Büsser empfohlen, nämlich "If the kids are united - Von
Punk zu Hardcore und zurück" (1998) und "Antipop" (1998), beide im Ventil-Verlag
erschienen.
Und weil's mal wieder gerade so gut paßt, und mir Heiko da sicher
zustimmen wird: Es ist nicht unmöglich, die symphonische Breite des 70er
Jahre-Progressiv-Rock mit der Geisteshaltung von Punk und Hardcore zu verbinden,
also den Hörer stark emotional anzusprechen und zugleich zu verstören.
Hört euch "Lift You Skinny Fists Like Antennas To Heaven!" von GODSPEED
YOU! BLACK EMPEROR an und danach die restlichen Erzeugnisse des Musiker-Kollektivs
aus Montreal, und ihr wißt, was wir meinen.
- Martin -
Wiederum ein kurzer Abriß fast eines halben Jahrhunderts Popmusik, diesmal
aus dem Jahre 1996. Rumpfs Herangehensweise ist, zumindest partiell, etwas persönlicher
koloriert sowie mehr ins Detail vordringend als Büssers Variante und erreicht
somit zwangsläufig mit rund 200 Seiten den doppelten Umfang. Älteren
Semesters (Jahrgang '52) fühlt Wolfgang Rumpf, Redakteur bei Radio Bremen
und Lehrbeauftragter für Popjournalismus und Musikkritik an der Uni Oldenburg,
sich bei musikalischen Stilen wie Beat, Blues oder Soul spürbar am wohlsten.
So gibt er denn auch aus seinem reichhaltigen eigen-biographischen Erfahrungsschatz
eine ausführlichere Anekdote über seine den Beatles nachempfundene
Band The Dandymen, welche Ende der Sechziger die Beat-Schuppen der Republik
unsicher machte, zum besten.
Beim Beschreiben des Charakters der Punk-Explosion hält sich Rumpf - soweit
ich das mit meinem rudimentären Wissen beurteilen kann - noch recht wacker.
Als die Sprache allerdings auf den Heavy Metal kommt, werden, wie so oft zuvor,
wieder einmal die abgeschmacktesten Klischeebilder aus der Mottenkiste eines
eigentlich ahnungslosen, einen allenfalls oberflächlichen Blick riskierenden
Soziologen hervor gezerrt. Die ich allerdings nun nicht durch Nachplappern aktualisieren
und verbreiten möchte. Zweifellos jedoch reichen viereinhalb beiläufige
Seiten wirklich nicht aus, um einen vielgestaltigen Musikstil und seine soziale
Relevanz angemessen zu beleuchten.
Na, geschenkt.
Untragbar bleiben hingegen vereinzelte journalistische Aussetzer wie das Bezichtigen
der "zynischen US-Band Monster Magnet", welche 1995 besonders perfide
die 60er zitiert haben soll, indem sie Songs des verrückten Sektengurus
und Mörders Charles Manson verwendete. Davon habe zumindest ich noch nie
gehört, das augenscheinlich angesprochene 95er Album "Dopes To Infinity"
auch zufälligerweise bei mir im Schrank stehen und im Booklet nach Hinweisen
auf Manson-Sympathisantentum oder -Kompositionen vergeblich gesucht.
Dann schreibt er einen Song aus Ozzys Solokarriere Black Sabbath zu. Gut, das
kann mal passieren und wäre ja noch mit einem Schmunzeln lässig abzutun
- und ich wäre sicher der Letzte, der über Recherchefehler anderer
Schreiber Schadenfreude sich zugestehen dürfte. Jedoch mit einer unterstellenden
Aussage wie "daß sich ein Fan nach tagelanger Selbstberieselung mit
ihrem Song "Suicide Solution" tatsächlich umbrachte, war da < bei
Sabbaths Tour Mitte der 90er > bereits längst vergeben und vergessen."
Black Sabbath für jenen bedauerlichen Vorfall, für welchen man bereits
damals Ozzy mit Freispruch endendem Ausgang vor Gericht zerrte, explizit und
ausschließlich in die Verantwortung zu nehmen, halte ich für eine
arglistig und berechnend erscheinende, empörende Verleumdung. Man sollte
im allgemeinen, und im besonderen wenn man ein Sachbuch verfaßt, solcherart
billige und aus der Luft gegriffene Polemik versuchen zu vermeiden. Zugegeben,
der letzte Vers des besagten Songs mit seiner - aus der Erinnerung zitierten
- Zeile "...and suicide seems the only way out" ist nicht unproblematisch. Wenn
man ihn jedoch, wie man natürlich sollte, im Zusammenhang mit den vorhergehenden
Versen liest, erschließt sich recht deutlich, daß es hierbei um
die autobiographische Beschreibung von Alkoholismus geht und die damit verbundene
Warnung, daß fortgesetzter schwerer Alkoholmißbrauch in letzter
Konsequenz in eine depressive Sackgasse führen kann, welche einem den eigenen
Freitod schließlich als einzig verbliebenen Ausweg erscheinen läßt.
Was vielleicht außerdem im inhaltlichen Bereich noch ein wenig störend
wirkt, ist das perpektivische Übergewicht auf Äußerlichkeiten
und Image, wenn die Sprache beispielsweise auf Pop-Style-Ikonen wie Queen, Guns'n'Roses
oder Madonna kommt. Zugegeben, bei manchen Künstlern spielt dieses
halt tatsächlich eine wesentlich dominierendere Rolle als eventuelle kompositorische
Qualitäten. Für die eine oder andere Showgröße scheint
die Musik selbst nur unwesentlich mehr zu sein, als ein hilfreiches Mittel zur
narzistischen Eigeninszenierung.
Demgegenüber wird der gesellschaftliche Kontext der unterschiedlichen Stitrichtungen
und Epochen im Buch eigentlich im Großen und Ganzen gut durchleuchtet.
Alles in allem, trotz meiner kleinen Vorbehalte, bleibt also dennoch eine recht
lesenswerte Abhandlung.
***(*)
Anders als Rumpf oder Büsser verzichtet Nick Hornby in seinem eigenen
kleinen Buch über das Phänomen Popmusik bewußt auf den großen
sozialen und historischen Überblick, zugunsten einer konsequent persönlich
gehaltenen, selektiven Komposition.
Seine Liebe zur Popmusik wurde bereits in seinen Romanen immer wieder einmal
evident. Wenn er in High Fidelity beispielsweise nicht nur dem von uns
allen sicherlich schonmal ausgesprochenen und aufgrund der technischen Entwicklung
beinahe zum reinen Anachronismus zerlaserten Satz "ich mach' dir mal'n Tape"
ein literarisches Denkmal setzt. Oder wenn der Einfluß und Werdegang einer
Band namens Nirvana in About A Boy zwanglos mit der Geschichte verwoben
wird und der Freitod von Kurt C. seine Entsprechung schließlich im "richtigen
Leben", in dem gescheiterten Versuch von Marcus' Mutter findet.
In 31 Songs findet Musik nicht mehr nur beiläufige Erwähnung,
sie steht im Mittelpunkt. Wobei jedoch hinter jedem der behandelten Stücke
ein übergeordnetes Thema sich aufbaut, es also sich über die Musik
hinaus gehend, wie selbstverständlich, unzählige Bezüge zum Leben
im allgemeinen und dem des Autors im besonderen ergeben. Es bleibt somit eher
unerheblich, ob man die behandelten Bands und Künstler nun mag oder aber
auch nicht, da deren Songs in den einzelnen Kapiteln zu einem guten Teil exemplarischen
Charakter gewinnen.
Bei "Thunder Road" von Bruce Springsteen (Martin? Wie sieht's aus, haha? Wir
warten auf die gehässige Klammerbemerkung...) beispielsweise zeigt Hornby
auf, wie ein Stück Musik einen Menschen scheinbar sein ganzes Leben lang,
durch alle Höhen und Tiefen hindurch, begleiten kann.
Bei einem Instrumental von Santana stellt er die Beziehung zwischen Sex und
Musik her.
Bei einem Song (ihr seht, ich hab' das Buch gerade nicht zur Hand...) handelt
er die verschiedensten Arten von Gitarrensoli ab, bei einem anderen beschreibt
er, wie beizeiten selbst bei jemandem wie ihm, der gerne seine grundsätzlich
atheistische Überzeugung hegt, plötzlich, unter dem überhöhenden
Einfluß harmonischsten klanglichen Geränkes, unerwartete religiöse
Empfindungen aufzuwallen pflegen.
Bei "I'm Like A Bird" von Nelly Furtado sinniert er über die Halbwertzeit
von Popmusik, denn ein eingängiger Dreiminutensong könne seine Geheimnisse
eben nicht ewig vor einem verbergen. Obwohl Nellys Debut-Album kaum etwas enthalte,
das so gut sei wie "I'm Like A Bird", findet es Hornby doch erstaunlich, wie
eminent die Anziehungskraft eines einzigen kleinen Liedes sein kann, wie regelrecht
süchtig man eine zeitlang danach werden könne.
Ein Ambient-Track an dem er gefallen fand, und der ihm kurz danach durch seine
inflationäre Verbreitung in Fahrstühlen, Werbung, Radioprogrammen
usw. fast verleidet wurde, steht exemplarisch für eine heutzutage kaum
zu vermeidende Reizüberflutung durch Popmusik (oder Information im
allgemeinen) und ihre Folgen. Gerade hier sind seine Schlußfolgerungen
sehr interessant.
Wie auch bei dem Stück namens "Frankie Teardrop" von einer Band mit dem
vielsagenden Namen Suicide, einer ultra-düsteren Klangcollage voller Verstörtheit
und Hoffnungslosigkeit. Hier hat er auf seine ganz eigene Weise den Reibungspunkt
zwischen den erbaulichen, beglückenden und den aufrüttelnden, provozierenden
Aspekten von Kunst abgehandelt. Ganz ähnlich in seiner Aussage, wie ich
selbst sie weiter oben traf, als es mich, gereizt durch Büssers Selbstgefälligkeit,
gegenentwurfbeflissen an die Tastatur trieb.
Was bereits seine Romane auszeichnet, unter anderem der trocken-lapidare britische
Witz, entwaffnende Ehrlichkeit und ungekünstelter Charme, zeigt seine neueste
Veröffentlichung ebenfalls überreich - 31 Songs ist einfach
ein, wer hätte bei Hornby ernsthaft anderes erwartet, verdammt geniales
Buch! Wenn ich selbst je eines über Popmusik schreiben sollte, müßte
es wohl genau so aussehen. Er würde so eine - natürlich in Zuneigung
mit sanft-ironischem Lächeln auf den Lippen gemachten und leicht überzogenen
- Einschätzung in aller Bescheidenheit weit von sich weisen, aber dieser
kleine, untersetzte, seines Haupthaars längst verlustig gegangene Engländer
mittleren Alters bestätigt einmal mehr, daß er zweifelsohne einer
der coolsten Typen ist, die derzeit unter der Sonne wandeln.
Für die im Juni 2004 erscheinende Taschenbuch-Ausgabe von 31 Songs
ergeht hiermit an alle unsere Leser ein ultimativer Kaufbefehl! Ich selbst werde
es mir dann ebenfalls holen - und das, obwohl die Aschaffenburger StaBi ein
gebundenes Exemplar im Regal stehen hat. Wer meinen unerschütterlichen,
ans Pathologische grenzenden Geiz kennt, weiß, daß kein kraftvolleres
Argument für dieses Buch gefunden werden kann.
******
Eigentlich wollte ich zukünftig unappetitliche Stories, in denen perverse,
mörderische Psychopathen ihr Unwesen treiben, tunlichst meiden. Was düstere,
spannungsgeladene Thriller angeht, läßt man sich - zumal bei der
begrenzten eigenen Kenntnis interessanter und anspruchsvoller Schriftsteller,
komplementär zur begrenzten Auswahl in der heimischen Bücherei - doch
immer wieder einmal hinreißen. Gerade Koontz schleicht sich oft ungerufen
in die engere Auswahl. Eben aus dem Grunde, weil er halt ein versierter Unterhaltungshandwerker
ist, der Spannung garantiert, bei dem jedoch nicht unangebrachte Gewaltdarstellungen
im Vordergrund stehen, sondern vielmehr die Entwicklung von Geschichten und
Charakteren. Zwar ist Koontz' Psycho kein zivilisierter Schöngeist wie
etwa Thomas Harris' Hannibal Lecter, doch sein von einer perversen Ideologie
unterfütterter Antrieb wird gut herausgearbeitet. Ebenso wie das Innenleben
der von ihm bedrohten Familie.
Die Auflösung wartet dann sogar noch mit einer relativ unerwarteten Pointe
auf.
Vom Aufbau erinnert "Das Versteck" ziemlich, vielleicht ein wenig zu sehr, an
des Autors gelungensten, tiefschichtigsten Roman "Brandzeichen". Ohne nun, so
ganz im allgemeinen, mit seinen Büchern überhaupt jemals in die Gefahr
irgendwelcher Orginalitätsverleihungen geraten zu können...
****
Kurz mit dem Blick gestreift.
Nochmal hingeschaut.
Ist das nicht...?
Blick abermals schweifen lassen.
Könnte es denn wirklich sein...?
Mit dem Blick diesmal festgenagelt und das Buch zur näheren Inspektion
aus dem Regal gezogen.
Tatsächlich, bei Joolz Denby handelt es sich, wie die Angaben zur Autorin
im Innern rasch offenbarten, um eben jene Joolz, die zum New Model Army-Umfeld
gehört, die alle Coverbilder der englischen Rockband malt und - soweit
mir bekannt - die Lebensgefährtin von Justin Sullivan ist. Vor dem Nürnberger
Hirsch trafen Martin und ich sie 1996 sogar mal kurz, als wir das Interview
mit Justin bestätigen wollten und Joolz zusammen mit dem Tour-Manager im
lockeren Plausch in der Nachmittagssonne sitzend vorfanden. Wir wechselten ein
paar Worte, wobei sie einen offenen, sympathischen Eindruck hinterließ,
drückten ihr unser Heft in die Hand und verabschiedeten uns dann relativ
zügig, um nicht über Gebühr zu stören (und noch einige Fragen
vorzubereiten, denn wir waren - muß es noch gesondert erwähnt werden?
- natürlich denkbar unzureichend vorbereitet...).
Mit Im Herzen Die Dunkelheit nun, legte Joolz vor wenigen Jahren
ihren Debut-Roman vor. Da das ganz und gar Unwahrscheinliche eintrat und ein
Exemplar in unserer kleinen heimischen Bücherei seinen Platz fand, war
es für mich Ehrensache, das Teil mitzunehmen und zu lesen. Es handelt sich
dabei um einen außergewöhnlichen Thriller, der in Joolz' Heimatstadt
Bradford angesiedelt ist, also auf bekanntem Terrain, was bei einem Debut sicher
von Vorteil ist und die detailierte Beschreibung der Lokalität und des
Milieus wesentlich erleichtert. In einer Wohngemeinschaft der dortigen Boheme
nistet sich David (Name v. d. Red. geändert) ein, die neue Beziehung von
Jamie, welche die unangenehme Angewohnheit hat, sich selbstquälerisch nur
die übelsten Kerle an Land zu ziehen. Wie sich nach und nach herausstellt,
ist David die unangenehmste vorstellbare Wahl, entpuppt er sich doch schließlich
als eben jener Serienmörder, der die Stadt bereits seit Monaten in Atem
hält...
Das klingt erstmal nach dem üblichen Schema, dieses wird jedoch durch Joolz'
unkoventionellen Stil aufgebrochen, der einerseits sehr authentisch und direkt,
andererseits - vom Finale abgesehen - Gewalttätigkeit nur andeutend und
mit einigem psychologischem Feingefühl daher kommt. Die Sprache ist, um
den Charakteren umso mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, sowohl ungeschliffen
und unverblümt - was einigen zartbesaiteten Gemütern mißfallen
könnte - , aber auch voller Empfindsamkeit. Als effektiver Einfall erweist
sich, die Rolle der Ich-Erzählerin nicht der Hauptperson zu übertragen,
sondern deren bester Freundin, die voll involviert ist und dennoch mit etwas
Abstand die Entwicklung des Dramas zu überblicken vermag. David und Jamie
sind letztlich beides tragische Figuren, jede mit dunklen Flecken in ihrer Vergangenheit,
die sie wie ein abgekapseltes Steinkind (Stone Baby, so der Originaltitel)
mit sich herumtragen und die unverarbeitet beständig ihre Persönlichkeit
ihr Handeln unbewußt mehr oder weniger mitbestimmen.
Ein beachtenswertes Debut.
****
Der russischstämmige Autor des Bestsellers Russendisco (noch nicht
gelesen, bei Gelegenheit vielleicht mal) faßte in diesem episodenhaften
Büchlein seine Erlebnisse während zahlreicher Lesereisen durch die
deutschen Lande zusammen. Bei der Beschreibung von Städten, Situationen
und natürlich den Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen legt
Kaminer einen sehr offenen, wertungslosen, fast schon kindlich-naiven Blick
an den Tag, der umgehend die Sympathien des Lesers gewinnt.
Gewöhnlich ist das Adjektiv nett ja eher negativ belegt, im Sinne
von ganz in Ordnung, eigentlich aber langweilig; in diesem Fall möchte
ich es verwenden und trotzdem positiv verstanden wissen. In dieser schlichten
und doch, oder gerade deswegen einfühlsamen Reflexion ausschnitthafter
alltäglicher Realitäten von Land und Leuten, welche des Humors durchaus
nicht entbehren muß, verbreitet sich völlig ungezwungen Verständnis,
Verständigung und unaufdringliche humanitäre Gesinnung.
Empfehlenswert als leichte Urlaubslektüre, wenn man sich mal etwas beiläufig
Verdauliches eingeben möchte, ohne gleich in banaler Seichtheit umherzutappen
und das Gefühl haben zu müssen, nur seine kostbare Zeit zu verschwenden.
***(*)
Als Zeitverschwendung möchte ich auch die letzte, flockige 860 Seiten
starke Schwarte von unser aller S. K. ungern abqualifizieren. Allerdings - die
zusammen gestellten UFO-Beobachtungs-Schlagzeilen von Roswell bis heute als
Einstimmung lassen es ahnen - sollte man nicht unwillens sein, sich die x-te
Story über fiese Außerirdische, die sich, ohne gültige Einreise-Visa
vorweisen zu können, auf unserem Heimatplaneten einzunisten trachten, welche
zudem allzu deutlich Versatzstücke aus Alien oder The Body Snatchers
breit tritt, über sich ergehen zu lassen. Mit von King bereits Gewohntem
wird ebenso beim Personal aufgewartet: etwa den vier alternden Jugendfreunden,
die in der Einsamkeit der Wildnis eine unheimliche Begegnung haben - klassische,
wie immer sehr gut und mit breiten Pinselstrichen gezeichnete Charaktere; oder
aber der übliche durchgeknallte Militärbefehlshaber, der nicht eben
zimperlich ist in der Wahl seiner Mittel, um die bedrohliche Situation zu bereinigen,
welcher vollkommen im überzeichnet psychopathologischen Klischee steckenbleibt.
Einen jederzeit drohenden vorzeitigen Break verhinderte Kings zupackender Stil
und die immense Spannung. Als richtiges Highlight darf der fintenreiche, allein
in dessen Bewußtsein ausgetragene Kampf zwischen Jonesy und den ihn befallenden,
zu übernehmen und psychisch völlig auszulöschen drohenden extraterrestrischen
Sporen gewertet werden, welcher sich zum entscheidenden, fulminanten Psychoduell
auswächst.
Insgesamt nichts wirklich Zwingendes also, Licht und Schatten. Auch wenn King
mit Das Monstrum das Thema schonmal intelligenter und zudem unterschwelligem
gesellschaftssatirischem Anspruch abgehandelt hat, und man ihm wünscht,
er würde sich endlich von diesen wiederkehrenden, zunehmend langweilenden
Horror-Standards lösen (Der Buick fiel mir vor Monaten mal in die
Hände und dürfte, geht man nach Titel und Klappentext, eigentlich
nichts anderes als ein Klon der guten alten Christine sein...), kann
man sich Dreamcatcher andererseits aber durchaus geben.
***(*)
Nachdem ich ein interessantes Interview mit der Autorin in der 3Sat Kulturzeit
sah, war ich nicht wenig gespannt auf ihr Werk. Zumindest Oryx Und Crake,
soweit ich weiß ihre letzte VÖ, konnte mich nicht so recht überzeugen.
Es geht darin um das Überleben eines vereinzelten Menschen in einer von
Umweltkatastrophen zerstörten nahen Zukunft, der in Rückblenden sein
Leben und seine degenerierende, dahinsiechende Zivilisation betrachtet und rekonstruiert,
wie es soweit kommen konnte.
Gut und durchaus intelligent geschrieben, ohne Zweifel, ich schaffte trotzdem
nur 200 der 380 Seiten, da es mir zu pessimistisch, trist, nun ja, auch schlicht
zu langweilig wurde...
**(*)
Der schwedische Autor Henning Mankell wurde ja durch seine Krimis um den Kommissar Wallander zum internationalen Bestseller. Dieser Roman ist nun etwas vollkommen anderes. Er handelt von einem sterbenden Straßenkind in Mosambik, Afrika, das einem Bäcker in mehreren aufeinander folgenden Nächten sein Leben erzählt. Eine Präsenz und Geschichte, die dessen eigenes Dasein gänzlich verändert.
Wenn ich mich auch ein wenig hindurchnötigen mußte, dennoch ein interessantes und gefühlvolles Dokument über eine fremde Lebenswirklichkeit in einem fernen, kaum weniger fremdartigen Kontinent.
***(*)
Auch dieses zufällig bei den Neuerscheinungen in der Bücherei entdeckte
Buch lieh ich mir eigentlich mit der Intention aus, halt nur mal kurz rein zu
schnuppern, den einen oder anderen Artikel zu lesen, die eine oder andere Erinnerung
aufzufrischen... Was soll ich sagen - binnen drei Tagen hatte ich den gesamten
Jubiläums-Band durchgezogen! Nicht allein die letzten fünfzehn, zwanzig
Jahre welche ich als Fußball-Interessierter bewußt miterlebte, sondern
genauso die vorangegangenen Jahrzehnte ließen sich voller Faszination
nachvollziehen, welche in den packend und mit journalistischer Genauigkeit verfaßten
Beiträgen wiederauflebten. Jedes Jahrzehnt wird dabei eröffnet von
Berichten über besondere Ereignisse und Entwicklungen, sowie Portraits
herausragender Persönlichkeiten. Anschließend wird in einer Chronik
jede Saison kompakt Revue passieren lassen, die Geschicke von Trainern, Spielern
und Vereinen im ringen um den Klassenerhalt oder die Meisterschaft. Welch' spannungsgeladene
Dramen sich da jedes Jahr auf's Neue abspielen... Man denkt unwillkürlich
an den atemlosen Abstiegskrimi 1999 zwischen Rostock, Nürnberg und unserem
regionalen Vertreter Eintracht Frankfurt - unglaublich, was da abging, einfach
unglaublich! Oder die Horror-Finale in der Meisterschaft von Bremen 1986, Leverkusen
2000 und Schalke 2001, als sicher geglaubte Triumphe von sympathischen, mitunter
begeisternd aufspielenden Mannschaften, sich am letzten Spieltag binnen Minuten
in Häufchen Asche verwandelten - und am Ende jeweils wieder einmal die
-uaaarrrrggh!- Bayern aus München jubeln durften. Oder 1992, als die Eintracht
so nahe wie nie am Titel war (okay, 1959 in der Amateurliga haben sie ihn einmal
geholt, immerhin) und wiederum am letzten Spieltag unnötigerweise bei Hansa
Rostock alles vergeigte (hätte Schiedsrichter Alfons Berg das begangene
Foul an Ralf Weber nicht übersehen, sondern mit dem berechtigten Elfer
geahndet, wäre es anders gelaufen!), während die Schwaben aus Stuttgart
mit einem Kopfballtreffer von Guido Buchwald kurz vor Schluß das Unwahrscheinliche
klar machten. Frankfurts Trainer Darogslav Stepanovic fand einen prägnanten
Satz voll schlichter Weisheit angesichts der erschütternden Niederlage:
"Lebbe geht weider"... Oder aber die sensationelle Meisterschaft von Kaiserslautern
1998, die unter der Führung von Otto Rehhagel das Novum schafften, aus
der 2ten Liga aufzusteigen und sich umgehend die Deutsche Meisterschaft zu sichern.
Oder... Oder... Oder... Oder... Oder...
Die punktuellen Höhepunkte aus vierzig Jahren Bundesliga, ein schön
aufgemachter, bunter Strauß von Ereignissen, den man sich für rund
elf Euro durchaus gönnen kann.
In diesem Jahr, um einmal ein abschließendes kurzes Schlaglicht auf die
Gegenwart zu werfen, sieht's sieben Spieltage vor Schluß für die
Eintracht mal wieder mehr als bedrohlich aus und Werder Bremen, denen wir alle
den Triumph herzlichst wünschen, könnte bei noch sieben Punkten Vorsprung
und zwei Unentschieden in Folge, ähnlich 1986 auf der Zielgeraden tatsächlich
wider allen Erwartungen die Luft ausgehen und noch abgefangen werden. Alles,
alles, nur bitte erspare man uns Fußball-Fans dieses Jahr das grausame
Deja Vu des Anblicks siegestrunkener bayuwarischer Horden, die, durch's Olympiastadion
trabend, schon wieder und inzwischen allzu routiniert, die silberne Schale schwenken....
******
Der schon wieder - aber ja!
Mit diesem seinem Debut (und nicht High Fidelity wie ich fälschlicherweise
-mies recherchiert bzw. vom Verlag etwas in die Irre geleitet - annahm) legte
Hornby anno 1992 das vielleicht geilste Buch über Fußball vor, das
jemals geschrieben wurde! Es bezeugt einmal mehr, daß dieser eben weit
mehr ist, als "nur ein Spiel", sondern schlicht und einfach für einen wirklichen
Fan, einen bedingungslosen Anhänger seines Clubs (in Hornbys Fall Arsenal
London, dieses Jahr, Ende März, noch immer auf der Jagd nach dem möglichen
sagenumwobenen Triple - welches sie dann mit dem Aus in FA-Cup und Champions
League binnen vier Tagen lausig verzockten; das aber nur nebenbei...) das pralle
Leben in all seinen Facetten! Ein prägnanter Teil des Daseins und mehr
noch, eigentlich ein in sich abgeschlossenes Kontinuum für sich. Eine eigene
Welt mit eigenen Regeln und Ritualen, eigenem Umfeld und Akteuren, eigenen Freuden
und eigenen Leiden, welche für nachsichtig das Haupt schüttelnde Außenstehende
nur schwerlich nachvollziehbar sein dürften. Wer sich sowieso für
Fußball in seinen mannigfaltigen Aspekten interessiert, sollte sich diesen
packenden, authentischen Erfahrungsbericht nicht entgehen lassen. Doch ebenso
Leute mit einer notorischen Abneigung gegenüber dem Treiben rund um das
runde Leder sollten gefallen daran finden können, denn wie immer bildet
das Kernthema bei Hornby nur die Basis für seine vielschichtigen, intelligenten
Beobachtungen, launigen Selbstbetrachtungen und erhellenden Anekdoten. So konstatieren
wir in diesem Fall grob überschlagen 55% Autobiographie, 35% Sozialstudie
und 10% Fußballbeschreibung. (Ja, rechnen Sie ruhig nach..!) Nick Hornby
geht auf alle möglich erscheinenden Aspekte während der 24 das Buch
ausmachenden Jahre seines Fan-Seins in und außerhalb der Stadien ein,
beschreibt Typen und Begebenheiten, und bleibt natürlich nach wie vor einer
der kunstvollsten Vertreter der schonungslosen Selbstanalyse.
Auf Einzelheiten einzugehen möchte ich, wie meist, verzichten. Das überläßt
man besser dem Autoren und seinem Schriftwerk selbst.
Und hier lohnt es sich ungemein, sich dieses auch wirklich zu gönnen.
Genial, was sonst.
******
Ich habe fertig.
- Heiko - I. Quartal 2004