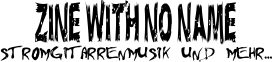

„Manche tanzеn, manche sitzen still und
träumen das
Leben erneut. Ich hoffe, sie werden
nie erwachen...“
(aus: EA80 – Waldmenschen)
 Ein erstes Album in den frühen Achtzigern,
dann über viele Jahre keine weitere LP mehr, bis 2010 und 2018: Die
Amerikaner ASHBURY machen sich recht rar, was Veröffentlichungen
angeht. Mit ihrem selbstproduzierten Erstling erinnern sie mich ein
wenig an MANILLA ROAD, von der Gestaltung der Albumcover (siehe deren
ebenfalls 1983 veröffentlichtes Album „Crystal Logic“) bis zum
Vertrauen auf die Eigeninitiative (beide Scheiben erschienen zunächst
jeweils auf bandeigenem Label). Auch musikalisch ist mit dem Hang zum
Epischen manche Gemeinsamkeit vorhanden, wobei MANILLA ROAD allerdings
härter und eindeutig metallischer waren.
Ein erstes Album in den frühen Achtzigern,
dann über viele Jahre keine weitere LP mehr, bis 2010 und 2018: Die
Amerikaner ASHBURY machen sich recht rar, was Veröffentlichungen
angeht. Mit ihrem selbstproduzierten Erstling erinnern sie mich ein
wenig an MANILLA ROAD, von der Gestaltung der Albumcover (siehe deren
ebenfalls 1983 veröffentlichtes Album „Crystal Logic“) bis zum
Vertrauen auf die Eigeninitiative (beide Scheiben erschienen zunächst
jeweils auf bandeigenem Label). Auch musikalisch ist mit dem Hang zum
Epischen manche Gemeinsamkeit vorhanden, wobei MANILLA ROAD allerdings
härter und eindeutig metallischer waren.
Beide Bands haben außerdem etwas Eigentümliches an sich, das heute mit dem Begriff „kauzig“ belegt wird. Lässt man die Musik auf sich wirken und dies vor allem mit Blick auf den musikalischen Zeitgeist von 1983 in den Genres Hardrock und Heavy Metal, würde einem die Vokabel „modern“ wohl kaum als erste einfallen. Die Produktion auf „Endless Skies“ wirkt warm und erdig, in ihrer Ausstrahlung eher in den Siebzigern angesiedelt. Vergleiche mit WISHBONE ASH oder JETHRO TULL werden in Zusammenhang mit dem ASHBURY-Debüt gern bemüht, was ja stimmt: diverse Gitarrenmelodien und Gesangslinien verweisen eindeutig auf die genannten Bands.
Der etwas mystisch und weltabgewandt wirkende Charakter der ASHBURY-Musik mag damals vielleicht sogar belächelt worden sein, wie aus der Zeit gefallen oder von gestern kommend. Das ist heute, in einer teilweise doch sehr hektischen Welt, für nicht wenige Fans ein Gütesiegel für entschleunigte und in sich ruhende Musik. Der harmonische Gesang, die akustischen Passagen und gutes Handwerk machen „Endless Skies“ zur lohnenswerten Anschaffung. Leichte Abzüge in der B-Note gibt es für das Instrumental „No Mourning“, für meinen Geschmack mit etwas zu viel „Gitarrengedudel“ angereichert (Fans werden nun vielleicht mit Dartpfeilen nach mir werfen, aber der Track hätte halt schon etwas überzeugender ausfallen können).
Was die Erhältlichkeit des Albums angeht,
meinte es vor allem der deutsche Markt gut mit der Platte, die nach
ihrer Wiederentdeckung in den 2000er Jahren diverse Male auf LP in
verschiedenen Vinylfarben neu aufgelegt wurde. Auch an die CD-Käufer
wurde gedacht, denn es muss ja nicht alles, was als „Kult“ gilt,
ausschließlich auf Platte erscheinen oder auf LP gehört werden, weil
nur auf diesem Medium die wahre Aura spürbar wird. Der Reiz von
Vinyl-Pressungen ist natürlich nachvollziehbar, aber mitunter auch
ziemlich kostspielig.
- Stefan - 10/2025
 Wir schreiben das Jahr 1989: Das britische
Knüppel-Kommando NAPALM DEATH muss einen erheblichen Aderlass
hinnehmen. Neben Gitarrist Bill Steer (konzentriert sich nun auf
CARCASS) verlässt auch Sänger Lee Dorrian die Band, des Vollgas-Lärms
überdrüssig geworden. Sein wirkliches Interesse gilt nun dem Doom
Metal, seine neue Formation CATHEDRAL nimmt schnell konkrete Formen an.
Im Zeitraum 1990/91 erscheinen zwei Demotapes und auch gleich das
Debütalbum „Forest of Equilibrium“.
Wir schreiben das Jahr 1989: Das britische
Knüppel-Kommando NAPALM DEATH muss einen erheblichen Aderlass
hinnehmen. Neben Gitarrist Bill Steer (konzentriert sich nun auf
CARCASS) verlässt auch Sänger Lee Dorrian die Band, des Vollgas-Lärms
überdrüssig geworden. Sein wirkliches Interesse gilt nun dem Doom
Metal, seine neue Formation CATHEDRAL nimmt schnell konkrete Formen an.
Im Zeitraum 1990/91 erscheinen zwei Demotapes und auch gleich das
Debütalbum „Forest of Equilibrium“.
EPs mit ausladender Spielzeit stehen in guter Tradition bei CATHEDRAL,
so auch im Fall des ersten Demos, wobei der Lateiner in uns sofort
erkannte, dass der Titel „In Memorium“ nicht ganz korrekt war und es
natürlich „Memoriam“ heißen musste (bei späteren Releases entsprechend
korrigiert). Das Tape war so gut, dass es wenige Jahre später auch auf
CD und Vinyl erschien. Noch mit Ben Mochrie (später bei WALL OF SLEEP)
am Schlagzeug kam das Demo auf eine Länge von satten 29 Minuten und
überzeugte musikalisch sofort, selbst wenn das Klangbild noch etwas
rumpelig tönt (die krawallige Death/Grind-Phase war für Sänger Lee halt
noch nicht so lange vorbei, was man gelegentlich auch hört).
Wo die neuen Bezugspunkte nun lagen, machte die PENTAGRAM-Coverversion
„All your Sins“ klar, wobei die US-Doomer in den frühen Neunzigern
selbst zu neuer Bekanntheit kamen. Dass CATHEDRAL in einem frühen
Entwicklungsstadium steckten, ist auf dem Demo zwar zu bemerken, doch
die musikalische Reife entpuppt sich bereits hier als bemerkenswert.
Die Eigenkompositionen bewegen sich im Bereich von sieben bis acht
Minuten, werden aber nicht langweilig. Ein echtes Highlight ist das
langsam vor sich stampfende Instrumental „March“ mit seinen wuchtigen
Riffs, ein krönender Abschluss für „In Memoriam“.
 Ein Sprung ins Jahr 1994: Bei CATHEDRAL stehen mittlerweile
zwei Alben plus diverse Singles auf der Habenseite, die Band ist nun
fest etabliert. Dem Hang zu langen EPs folgend erscheint mit „Statik
Majik“ ein 40minüter, der selbst dann noch LP-Laufzeit hätte, würde man
den bereits bekannten Track „Midnight Mountain“ abziehen. Bei der Tour
mit BLACK SABBATH kam es zwar zu personellen Turbulenzen (Joe
Hasselvander und Victor Griffin von PENTAGRAM mussten aushelfen), aber
musikalisch war der mit Seventies-Einflüssen angereicherte Doom voll
auf der Höhe.
Ein Sprung ins Jahr 1994: Bei CATHEDRAL stehen mittlerweile
zwei Alben plus diverse Singles auf der Habenseite, die Band ist nun
fest etabliert. Dem Hang zu langen EPs folgend erscheint mit „Statik
Majik“ ein 40minüter, der selbst dann noch LP-Laufzeit hätte, würde man
den bereits bekannten Track „Midnight Mountain“ abziehen. Bei der Tour
mit BLACK SABBATH kam es zwar zu personellen Turbulenzen (Joe
Hasselvander und Victor Griffin von PENTAGRAM mussten aushelfen), aber
musikalisch war der mit Seventies-Einflüssen angereicherte Doom voll
auf der Höhe.
Besonders die Tracks 3 und 4, zusammen eine halbe Stunde lang, haben
sich über die Jahrzehnte sehr gut gehalten: „Cosmic Funeral“ ist mit
feinen Riffs gesegnet, während das 23 Minuten lange „The Voyage of the
Homeless Sapien” den ungewöhnlichsten Song der EP bildet. Das überlange
Stück ist nicht etwa mit ausgedehnten Drone-Sounds oder ähnlichen
Spielereien bequem auf Länge gebracht, sondern sauber durchkomponiert,
wobei es der Band gelingt, sehr unterschiedlich klingende Passagen so
miteinander zu vereinen, dass der Song trotzdem nicht in seine
Einzelteile zerfällt. Die US-Version der EP mit dem Titel „Cosmic
Requiem“ verzichtet auf „Midnight Mountain“ und hat dafür „A Funeral
Request“ (leicht umgetitelt allerdings) von der Japan-Version des
zweiten Albums „The ethereal Mirror“ an Bord, außerdem ein anderes
Artwork. Welche Variante es auch sein soll, der Gegenwert ist enorm und
stellt unter Beweis, dass CATHEDRAL seinerzeit richtig gut in Form
waren und innerhalb weniger Jahre gekonnt ihren eigenen Bandsound
entwickelt hatten.
- Stefan
- 10/2025

 Es war vor Jahren in einem Edeka-Markt, nach
einer Sitzung der ZWNN-Redaktion (zwei ältere Herren treffen sich in
der Kneipe oder im Biergarten): Der samstägliche Einkauf führt mich an
der Gemüseabteilung vorbei, wo ein ca. zwanzigjähriger Mitarbeiter
hingebungsvoll die Zucchini sauberwischt. Die Zen-artige Gelassenheit
seines Tuns korrespondiert mit seinem SLEEP-Shirt, was mich doch
überrascht. Die junge Generation hört Rumpelmusik für uns Ältere? Das
muss honoriert werden und sei es mit einer Erwähnung in dieser
Herbstrubrik, was hiermit geschehen ist.
Es war vor Jahren in einem Edeka-Markt, nach
einer Sitzung der ZWNN-Redaktion (zwei ältere Herren treffen sich in
der Kneipe oder im Biergarten): Der samstägliche Einkauf führt mich an
der Gemüseabteilung vorbei, wo ein ca. zwanzigjähriger Mitarbeiter
hingebungsvoll die Zucchini sauberwischt. Die Zen-artige Gelassenheit
seines Tuns korrespondiert mit seinem SLEEP-Shirt, was mich doch
überrascht. Die junge Generation hört Rumpelmusik für uns Ältere? Das
muss honoriert werden und sei es mit einer Erwähnung in dieser
Herbstrubrik, was hiermit geschehen ist.
Die zwischenzeitlich Ende der Neunziger aufgelöste Band ist wieder
aktiv und das beinahe in der Besetzung, die schon auf dem 1992er Album
„Sleep’s Holy Mountain“ zu hören war. Am Schlagzeug saß bei „The
Sciences“ Jason Roeder von NEUROSIS, Al Cisneros (bs/voc) und Matt Pike
(git) sind geblieben. Unverändert ist auch der große Einfluss von BLACK
SABBATH, der schon zu frühen EP-Zeiten (siehe die Single von 1991)
zelebriert wurde, inklusive Hommage an das Artwork der vierten
Sabbath-Scheibe von 1972.
Nach dreiminütigem Intro, einem Sich-Eingrooven mit Gefiepe und
brummelnden Gitarrensounds, geht es los und für die nächsten 50 Minuten
hat man das Gefühl, die Band wandert mehr oder weniger durch einen
großen Song, der nur der Bequemlichkeit halber in diverse Einzeltracks
portioniert wurde. Durch den markanten Gesang und den Gitarrensound
gibt es einen recht hohen Wiedererkennungswert, SLEEP-Material lässt
sich dadurch ohne größere Schwierigkeiten identifizieren. Das Auswalzen
der Riffs führt zu gelegentlichem Abschweifen, aus dem die Band dann
aber wieder in songdienliches Terrain zurückkehrt.
 Ordentlich gekifft wird wohl auch im SLEEP-Lager, wenn man
zumindest oberflächlich die Texte studiert, aber das soll uns nicht
weiter stören. Die Songstrukturen wabern kaum überraschend oft über
zehn Minuten hinaus und variieren die musikalischen Motive, setzen
weniger auf markante individuelle Höhepunkte. Ein Problem für Hörer,
die es prägnant auf den Punkt formuliert mögen.
Ordentlich gekifft wird wohl auch im SLEEP-Lager, wenn man
zumindest oberflächlich die Texte studiert, aber das soll uns nicht
weiter stören. Die Songstrukturen wabern kaum überraschend oft über
zehn Minuten hinaus und variieren die musikalischen Motive, setzen
weniger auf markante individuelle Höhepunkte. Ein Problem für Hörer,
die es prägnant auf den Punkt formuliert mögen.
Stoner-Doom-Freunde sollten damit jedoch klarkommen, zumal SLEEP
einfach eine funktionierende Formel gefunden haben, die sie
offensichtlich gut beherrschen. Riff um Riff wird um ein Zentrum
kreisend aneinandergefügt, der Sound driftet gekonnt in andere Sphären
ab. Das kann man jetzt langatmig finden oder aber sich davon mitnehmen
lassen. Ein schräger Humor vermutlich auch selbstironischer Art scheint
ebenfalls vorhanden zu sein, ein Songtitel wie „Giza Butler“ schlägt in
diese Kerbe (und nein, dieses Wortspiel erklären wir jetzt nicht). Das
gelungenste Stück ist mit „Antarcticans Thawed“ zugleich das längste
auf dem Album, wobei „The Sciences“ davon lebt, am Stück gehört zu
werden, ohne auf konventionelle Erwartungen Rücksicht zu nehmen. Eine
„Hitsingle“ oder Ähnliches drängt sich dabei natürlich nicht auf, das
würde dieser Form von Musik auch widersprechen.
- Stefan - 10/2025
 Eine Stimme, die man im Prinzip sofort
erkennt: Auch ohne seine frühere Band BAUHAUS im Rücken ist Peter
Murphy unmittelbar präsent. Seine Solokarriere, unterbrochen von
verschiedenen BAUHAUS-Comebacks, pausierte albumtechnisch gesehen nach
„Lion“ (2014) über zehn Jahre lang, bevor Murphy 2025 mit dem
vorliegenden Longplayer wieder in Erscheinung getreten ist. Weniger
sperrig als so mancher Track seiner früheren Band ist das Material auf
„Silver Shade“ zwischen düsterem Elektro-Pop und Goth-Rock angesiedelt,
durchweg eingängig und auch stimmlich präsentiert sich Murphy im Alter
von 68 Jahren mehr als respektabel.
Eine Stimme, die man im Prinzip sofort
erkennt: Auch ohne seine frühere Band BAUHAUS im Rücken ist Peter
Murphy unmittelbar präsent. Seine Solokarriere, unterbrochen von
verschiedenen BAUHAUS-Comebacks, pausierte albumtechnisch gesehen nach
„Lion“ (2014) über zehn Jahre lang, bevor Murphy 2025 mit dem
vorliegenden Longplayer wieder in Erscheinung getreten ist. Weniger
sperrig als so mancher Track seiner früheren Band ist das Material auf
„Silver Shade“ zwischen düsterem Elektro-Pop und Goth-Rock angesiedelt,
durchweg eingängig und auch stimmlich präsentiert sich Murphy im Alter
von 68 Jahren mehr als respektabel.
Allerdings dauert es etwas, bis das Album sein eigentliches
Qualitätslevel erreicht. Der vorab als Single ausgekoppelte Opener
„Swoon“ ist recht gut, hat aber über die Distanz von fünf Minuten
Laufzeit zu wenig Höhepunkte. Über die nächsten Nummern steigert sich
das Ganze aber bis zum auf Rang 4 platzierten Titeltrack recht zügig
und stellt unter Beweis, dass Peter Murphy seine markante
Ausdruckskraft nicht verloren hat. Die Stücke sind musikalisch eher
einfach strukturiert, was für die Zukunft bedeuten mag, dass sie sich
irgendwann abnutzen werden, aber das soll der Langzeittest zeigen – für
den Moment klingt das jedenfalls problemlos überzeugend. Zugegeben,
nicht jeder Song ist restlos gelungen und kompositorisch voll
ausgereift, da sollte auch die Wiederhörensfreude das Urteilsvermögen
nicht trüben. Das Positive überwiegt jedoch, etwa in Form einer
Dreierformation wie dem Titeltrack, dem nachfolgenden „The Artroom
Wonder“ und dem auch gesanglich epischer angelegten „The Meaning of my
Life“. Stilistisch liegt das recht nah beieinander, entwickelt aber
jeweils eigenen Charakter. Gelungen!

Kleinere Schönheitsfehler würde ich bei Randerscheinungen des
Sound-Designs ausmachen wollen: Die Beats zu Beginn von „Cochita is
lame“ etwa klingen doch ein wenig wie daheim am Rechner
zusammengeklöppelt oder nach einem frühen Demo (was sich härter lesen
mag als es gemeint ist, es sind ja nur Kleinigkeiten). Die Klänge auf
„Silver Shade“ sind von Elektro-Pop dominiert, Gitarrenlastiges à la
„Soothsayer“ findet sich nur selten und auch orientalische Einflüsse
(Murphy lebt schon seit Jahrzehnten in der Türkei) wie bei „Time waits“
tauchen kaum auf. Das sorgt allerdings, wenn es denn so weit ist,
definitiv für Abwechslung und hätte daher mehr Raum haben dürfen, zumal
die betreffenden Tracks auch noch gut sind.
Musikalisch wäre bei einigen Stücken sicher noch mehr herauszuholen,
was Dramaturgie und Instrumentierung betrifft. Was das Album über die
volle Distanz verlässlich trägt, ist die beeindruckende
Gesangsleistung, wobei es weniger um die Technik als um die
Persönlichkeit geht, die den Songs etwas mitgibt, was bei einer nicht
so unverwechselbaren Stimme kaum präsent wäre. Das abschließende „Let
the flowers grow“, ein Duett mit Boy George, gab es schon vor
Erscheinen der LP/CD und es ist auch hier ein Highlight. Noch lässt
sich zwar kaum ausmachen, wie sich „Silver Shade“ in zwei bis drei
Jahren im persönlichen Geschmackskosmos platziert haben wird, aber
jetzt und hier ist diese musikalische Rückkehr ein willkommenes
Lebenszeichen eines Musikers, der nicht von der Vergangenheit zehren
muss, um wahrgenommen zu werden.
- Stefan - 10/2025

 „The Ballad of Lucy Jordan“ lief in meiner
unzuverlässigen Erinnerung bis Mitte der 80er-Jahre mindestens einmal
pro Woche im Radio in der elterlichen Küche. Ich wusste nicht, wie das
Lied hieß, auch nicht den Namen der Sängerin, und da ich noch kein
Englisch konnte, hatte ich keine Ahnung, um was es in dem Lied ging.
Was mich jedoch sehr berührte, war diese oft kurz vor dem Brechen
stehende Stimme. Ich ahnte, dass hier eine traurige Geschichte erzählt
wurde, die von etwas handelte, mit dem ich damals noch nicht
konfrontiert gewesen war.
„The Ballad of Lucy Jordan“ lief in meiner
unzuverlässigen Erinnerung bis Mitte der 80er-Jahre mindestens einmal
pro Woche im Radio in der elterlichen Küche. Ich wusste nicht, wie das
Lied hieß, auch nicht den Namen der Sängerin, und da ich noch kein
Englisch konnte, hatte ich keine Ahnung, um was es in dem Lied ging.
Was mich jedoch sehr berührte, war diese oft kurz vor dem Brechen
stehende Stimme. Ich ahnte, dass hier eine traurige Geschichte erzählt
wurde, die von etwas handelte, mit dem ich damals noch nicht
konfrontiert gewesen war.
Nach einer kurzen Karriere als Popmusikerin in den 60er-Jahren und der
Bekanntheit als Freundin von Mick Jagger ging es mit Marianne Faithfull
fast das ganze Folgejahrzehnt abwärts: Fehlgeburt, Sorgerechtsentzug,
Essstörung, Heroinabhängigkeit, Suizidversuch, zeitweises Leben auf der
Straße. „Broken English“ war das
Comeback-Album. Auch wenn sie nur am
Titelsong und zwei weiteren Stücken songwriterisch beteiligt war,
reflektieren die Texte Faithfulls Erfahrungen der vergangenen Jahre.
Wie diese auch ihre Stimme beeinflusst haben, wird deutlich, wenn man
„As Tears Go By“ von 1964 zum Vergleich heranzieht.
 Das blaue Albumcover wirkt so unterkühlt wie die
New-Wave-artige Musik, die mit Elementen aus Post-Punk und Reggae
ergänzt wird. „Why D’Ya Do It?“ erinnert etwas an die Werke von Patti
Smith ein paar Jahre zuvor, oft sind die Texte aber skizzenhafter.
Während „Working Class Hero“ von John Lennon eine traurige Hymne an die
Arbeiterklasse ist, zelebriert Marianne Faithfull mit bedrohlicher
Bass- und Synthesizer-Begleitung einen illusionslosen Abgesang.
Das blaue Albumcover wirkt so unterkühlt wie die
New-Wave-artige Musik, die mit Elementen aus Post-Punk und Reggae
ergänzt wird. „Why D’Ya Do It?“ erinnert etwas an die Werke von Patti
Smith ein paar Jahre zuvor, oft sind die Texte aber skizzenhafter.
Während „Working Class Hero“ von John Lennon eine traurige Hymne an die
Arbeiterklasse ist, zelebriert Marianne Faithfull mit bedrohlicher
Bass- und Synthesizer-Begleitung einen illusionslosen Abgesang.
„Broken English“ war ein riesiger Charterfolg und ein Neustart in jeder
Hinsicht. Bis zu ihrem Tod im Alter von 78 Jahren im Januar dieses
Jahres folgten mehrere Alben und Auftritte in Filmen, am bekanntesten
dürfte hier „Irina Palm“ sein. Ich bin kein Experte für Marianne
Faithfull und auch für Metallica schon lange nicht mehr, darum stieß
ich erst bei der Recherche zu diesem Text auf das „The Memory
Remains“-Video von Metallica aus dem Jahr 1997, wo sie den Part von
Hetfield übernommen hatte, der den Song im Gedächtnis bleiben lässt.
Das Album ist auf Vinyl in gutem Zustand oft für wenige Euros in vielen
Second-Hand-Läden zu finden. Zum Weiterhören könnte „Before The Poison“
von 2004 empfohlen werden, wo Marianne Faithfull bei einigen Songs mit
der bewundernswerten PJ Harvey kollaboriert.
- Martin - 11/2025
 „Straßenreinigung tötet Herbstmusik“ könnte die Headline
lauten, wäre
ich Redakteur eines reißerischen Revolverblatts und der Blick aus dem
Fenster bescherte einem freie Sicht auf kürzlich noch stimmungsvoll von
buntem Laub bedeckte Gehwege. Ja, so muss man heute arbeiten, es wird
einem nicht leicht gemacht. Musikalisch schafft hier das im letzten
Jahr erschienene Soloalbum von ALICE IN CHAINS-Gitarrist Jerry Cantrell
Abhilfe, entstanden mit der Unterstützung prominenter Gastmusiker.
„Straßenreinigung tötet Herbstmusik“ könnte die Headline
lauten, wäre
ich Redakteur eines reißerischen Revolverblatts und der Blick aus dem
Fenster bescherte einem freie Sicht auf kürzlich noch stimmungsvoll von
buntem Laub bedeckte Gehwege. Ja, so muss man heute arbeiten, es wird
einem nicht leicht gemacht. Musikalisch schafft hier das im letzten
Jahr erschienene Soloalbum von ALICE IN CHAINS-Gitarrist Jerry Cantrell
Abhilfe, entstanden mit der Unterstützung prominenter Gastmusiker.
Cantrell standen dabei Kollegen wie Robert Trujillo, Duff McKagan oder
Mike Bordin zur Seite, wobei es dieses Namedropping gar nicht bräuchte,
denn das Album wäre auch ohne solche Verweise stark genug, um
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. „I want Blood“ ist der diesmal recht
zügig nach “Brighten” von 2021 erschienene Nachfolger, in den 2010er
Jahren hatte es keine einzige Soloscheibe von Cantrell gegeben. Das im
Eigenverlag veröffentlichte Werk dürfte auch gehobene Erwartungen
zufriedenstellen, interessierte Fans von ALICE IN CHAINS werden ohnehin
hellhörig geworden sein.
 Was die Struktur der Scheibe betrifft, könnte man zumindest
in Teilen
zwei Schwerpunkte ausmachen: auf der einen Seite die mit kraftvollen
Riffs angereicherte, etwas rockigere oder härtere Schiene, daneben vor
allem in der zweiten Hälfte dann die ein wenig ruhiger angelegten
Songs. Gelungen ist beides ausgefallen, somit kann man je nach Stimmung
das jeweils Ansprechende auswählen. Der Titeltrack zum Beispiel stellt
den „Rocker“-Typ dar, Stücke wie „Afterglow“ oder „Echoes of Laughter“
sind da zurückhaltender. Besondere Höhepunkte lassen gar nicht mal so
einfach benennen, das Album ist schon der klassische Longplayer, der
eindeutig von seinem Gesamteindruck lebt und das wirklich gekonnt
umzusetzen versteht.
Was die Struktur der Scheibe betrifft, könnte man zumindest
in Teilen
zwei Schwerpunkte ausmachen: auf der einen Seite die mit kraftvollen
Riffs angereicherte, etwas rockigere oder härtere Schiene, daneben vor
allem in der zweiten Hälfte dann die ein wenig ruhiger angelegten
Songs. Gelungen ist beides ausgefallen, somit kann man je nach Stimmung
das jeweils Ansprechende auswählen. Der Titeltrack zum Beispiel stellt
den „Rocker“-Typ dar, Stücke wie „Afterglow“ oder „Echoes of Laughter“
sind da zurückhaltender. Besondere Höhepunkte lassen gar nicht mal so
einfach benennen, das Album ist schon der klassische Longplayer, der
eindeutig von seinem Gesamteindruck lebt und das wirklich gekonnt
umzusetzen versteht.
Immer wieder klar erkennbar ist, wie auch bei SOUNDGARDEN früher, der
Sabbath-/Iommi-Einfluss im Gitarrenbereich. Cantrell ist da einem
musikalischen Background treu geblieben, der schon zu den frühen
Grunge-Zeiten in den Neunzigern vorhanden war. Was die
Gesangsphrasierung betrifft, kann man auch auf Iommis Soloscheibe aus
dem Jahr 2000 (ebenfalls mit prominenten Gastmusikern besetzt)
Bezugspunkte finden bzw. Gemeinsamkeiten wie etwa bei „Let it lie“,
ohne dabei jedoch simples Abkupfern unterstellen zu wollen. „I want
Blood“ ist auch nach mehrmaligem Durchlauf ein Album, das sich kaum
abnutzt. Es passt in die aktuelle Jahreszeit, findet eine ansprechende
Balance zwischen harter Gitarrenmusik und ruhigen Momenten. Auch der
Metaller mit gelegentlichen melancholischen Tendenzen dürfte hier wohl
problemlos fündig werden, wobei man sich mit genrebedingten
Berührungsängsten sowieso nicht weiter belasten sollte.
- Stefan - 11/2025

 Auch in einem bewusst sehr reduziert aufgenommenem und
produziertem Album wie „Nebraska“ liegt das Potenzial für etwas Großes,
wie das unlängst veröffentlichte Set mit vier CDs und einer Blu-ray
beweist (bei der Vinyl-Version der Expanded Edition sind es
entsprechend vier LPs plus Blu-ray). Das alles umfasst dann 15
unveröffentlichte Stücke, Solo-Outtakes, einen Film mit Performances
der Songs und natürlich auch eine in diesem Jahr remasterte Version des
eigentlichen Albums von 1982.
Auch in einem bewusst sehr reduziert aufgenommenem und
produziertem Album wie „Nebraska“ liegt das Potenzial für etwas Großes,
wie das unlängst veröffentlichte Set mit vier CDs und einer Blu-ray
beweist (bei der Vinyl-Version der Expanded Edition sind es
entsprechend vier LPs plus Blu-ray). Das alles umfasst dann 15
unveröffentlichte Stücke, Solo-Outtakes, einen Film mit Performances
der Songs und natürlich auch eine in diesem Jahr remasterte Version des
eigentlichen Albums von 1982.
Konzentrieren wir uns auf diese zehn Songs von damals, die überwiegend mit akustischer Gitarre und Springsteens Stimme betont sparsam instrumentiert sind. Wer den Boss erst mit dem Welterfolg „Born in the U.S.A.“ aus dem Jahr 1984 kennengelernt hatte, wird mit dem Material auf „Nebraska“ wohl etwas fremdeln, denn griffig und auch im kommerziellen Sinne mitreißend für den großen Radioeinsatz klingt hier zunächst kaum etwas, sondern im Gegenteil eher düster und deprimiert stimmend.
Kein Wunder bei all den Themen, die sich durch die Stücke ziehen: menschliche Niederlagen, Narben aus Beziehungen, Verluste, Gewaltverbrechen, Tod. Das kann nicht in ausgelassene und fröhliche Musik münden, vollkommen klar, macht „Nebraska“ damit aber auch zu einem schweren und nicht gerade leicht zugänglichen Werk. Da wird kein großes weites Land besungen mit ausgedehnten Horizonten und Möglichkeiten, sondern eine Welt und ein Leben, die einen beide auch niederdrücken können. Springsteen selbst verhehlte nicht, dass er sich damals in einer sehr schwierigen, depressiven Phase seines Lebens befand, wie sie auch im aktuellen Spielfilm „Springsteen: Deliver me from nowhere“ thematisiert wird.
Es hat schon fast etwas Tragisches, wenn ein charakterlich stabil gebliebener Mann wie Springsteen nur wegen seiner bisweilen geäußerten Kritik am System Trump heutzutage bei einigen als Verräter am eigenen Land gilt, wie man in Kommentaren auf YouTube nachlesen kann. Besingt dann einer auch noch die Schattenseiten der Heimat, gilt er als Nestbeschmutzer oder Schlimmeres. Den Erfolg des Albums verhinderten kleingeistige Kläffer freilich nicht, auch wenn der Nachfolger „Born in the U.S.A.“ in dieser Beziehung auf der Überholspur vorbeizog, als alle ausgekoppelten Singles die Top Ten der US-Charts erreichten.
„Nebraska“ hatte so etwas nicht zu bieten, was angesichts des Songmaterials jedoch als folgerichtig erscheinen musste. Springsteen schuf damit ein Album, das wie ein persönliches Statement in enger Verbindung mit seiner eigenen Lebenssituation wirkt und zugleich einen ungeschönten Blick auf Amerika wirft. Das wird mit Sicherheit auch heute noch von Randfiguren der Gesellschaft, denen das Leben schwer zugesetzt hat, verstanden werden können. Die Themen, die Springsteen hier besingt, sind ja im Grunde zeitlos und universell. Es mag sein, dass die Stimmung der Platte einen ganz schön runterziehen kann, aber urteilt man nach zahlreichen Fan-Kommentaren, scheint „Nebraska“ ihnen gerade deshalb viel zu bedeuten und ihnen auch Kraft für ihr Leben gegeben zu haben – was nach Jahrzehnten nicht oft über eine LP gesagt werden kann.
- Stefan - 11/2025
 Für Doom-Metal-Fans und CANDLEMASS-Anhänger ein echter
Feiertag: Vor etwas mehr als zwei Monaten standen CANDLEMASS in Athen
für einen Gig wieder in der „Nightfall“-Besetzung auf der Bühne, also
mit Messiah Marcolin am Mikro. Johan Langquist, Session-Sänger auf dem
ersten Album von 1986 und seit 2018 wieder fester Teil der Band, wird
aber noch als hauptamtlicher Frontmann geführt, also dürfte die
gefeierte Reunion wohl nur eine einmalige Sache gewesen sein (bei
CANDLEMASS und ihren Personalwechseln ist das allerdings auch nicht
unbedingt sicher).
Für Doom-Metal-Fans und CANDLEMASS-Anhänger ein echter
Feiertag: Vor etwas mehr als zwei Monaten standen CANDLEMASS in Athen
für einen Gig wieder in der „Nightfall“-Besetzung auf der Bühne, also
mit Messiah Marcolin am Mikro. Johan Langquist, Session-Sänger auf dem
ersten Album von 1986 und seit 2018 wieder fester Teil der Band, wird
aber noch als hauptamtlicher Frontmann geführt, also dürfte die
gefeierte Reunion wohl nur eine einmalige Sache gewesen sein (bei
CANDLEMASS und ihren Personalwechseln ist das allerdings auch nicht
unbedingt sicher).
Beginnend mit „Nighfall“ war die Besetzung damals für die Strecke von drei aufeinanderfolgenden Alben stabil und gleich die erste LP aus dieser Zeit ist bis heute ein Meilenstein geblieben. Hochdramatischer Doom Metal, dominiert von einem sich theatralisch inszenierenden Sänger, gediegen in der Präsentation: Das war 1987 bemerkenswert, als sich der Thrash Metal auch kommerziell etabliert hatte. Die großen Alben von Bands wie METALLICA oder SLAYER waren im Vorjahr erschienen und prägten gerade die jüngeren Metal-Fans, da fiel eine stilistisch ganz anders strukturierte Platte wie „Nightfall“ schon auf.
Nach einem kurzen Intro setzt „Well of Souls“ den markanten musikalischenTonfall mit ausladenden Riffs im Midtempo-Bereich, gekrönt von einem Sänger, den man stellenweise auch als etwas zu präsent empfinden kann, so stark ist seine Performance. Es mag Zufall gewesen sein, aber die Tracklist mit zehn Stücken enthält auch vier Instrumentalnummern, als hätte da eine Art Gegengewicht geschaffen werden sollen. Sobald Messiah Marcolins Gesang ertönt, wird schon klar, wer da gerade die Kommandogewalt übernommen hat, speziell beim die A-Seite abschließenden Duo „At the Gallows End“ und „Samarithan“.
Wer derart selbstsicher und verschwenderisch zwei der ganz großen Epic-Doom-Songs mal eben hintereinander folgen lassen kann, der muss gewusst haben, wie stark das Material des gesamten Albums war. Es gibt ja Platten, die einem nach Jahrzehnten gar nicht mehr so beeindruckend erscheinen wie zu Jugendzeiten, aber gerade mit so pathosbeladenen Klassikern wie „Samarithan“, die auch 2025 ihre Wirkung nicht verfehlen, hat „Nightfall“ sich einen vermutlich unzerstörbaren Status erarbeitet, der sich auch in den regelmäßigen Neuauflagen zeigt. Wer das große Paket benötigt, für den gibt’s Box-Sets in CD- und Vinylform, bei dem das Album mit alternativen Mix-Fassungen und Demo-Versionen ergänzt wurde.
Das unten verlinkte Video des inhaltlich an die Geschichte des Rattenfängers von Hameln angelehnten Songs „Bewitched“ zeigt während der etwas skurril anmutenden „Doom-Tanz“-Szene in einem verschneiten Park, inmitten einer für den Dreh rekrutierten Gruppe von Metalfans, auch den damaligen Sänger Per Ohlin alias „Dead“ von MORBID, der 1988 zu den Norwegern MAYHEM wechselte und sich im April 1991 das Leben nahm. Davon abgesehen, ist das Video im Schnitt insgesamt etwas unbeholfen und wirkt eher so, als hätte man diverses Material zusammengewürfelt, um daraus etwas Präsentables fürs Musikfernsehen zu zimmern. An der musikalischen Qualität ändert das freilich nichts und so bleibt „Nightfall“ (ohne hier ein echter Experte sein zu wollen) das wohl beste CANDLEMASS-Album.
- Stefan - 11/2025
