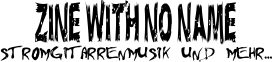

„Am besten, man lebt in
einer nicht zu schönen Gegend.
Weil einem sonst nichts einfällt."
(Thomas Bernhard)
 Auch Mitte der Neunzigerjahre war die Retroschiene bereits
kein einsames Nebengleis mehr: Doom Metal und Stoner Rock nahmen
kräftige Anleihen bei den Siebzigern, Schlaghosen und psychedelische
Artworks waren nicht selten anzutreffen. Das gilt auch für die Waliser
ACRIMONY, die anfangs mit todesmetallischen Begleiterscheinungen
gestartet waren, dann aber ihrer Seventies-Schlagseite freien Lauf
ließen. Durchaus gekonnt, wobei ich der hier vorliegenden zweiten LP
den Vorzug geben würde.
Auch Mitte der Neunzigerjahre war die Retroschiene bereits
kein einsames Nebengleis mehr: Doom Metal und Stoner Rock nahmen
kräftige Anleihen bei den Siebzigern, Schlaghosen und psychedelische
Artworks waren nicht selten anzutreffen. Das gilt auch für die Waliser
ACRIMONY, die anfangs mit todesmetallischen Begleiterscheinungen
gestartet waren, dann aber ihrer Seventies-Schlagseite freien Lauf
ließen. Durchaus gekonnt, wobei ich der hier vorliegenden zweiten LP
den Vorzug geben würde.
Das gesamte Schaffen der Band umfasst neben den beiden Studioalben auch einige Sampler- und EP-Tracks, die zwar nicht alle auf der Compilation „Chronicles of Wode“ von 2019 vertreten sind, was aber keineswegs gegen diese 3-CD-Edition spricht, die man noch recht günstig bekommen dürfte. Die CD-Erstauflage von „Tumuli Shroomaroom“ sorgt optisch für einige Misstöne, denn das Layout wirkt wie von einem billigen 90er-Eurodance-Sampler inspiriert (und passt einfach nicht so recht zur Musik). Die Vinyl-Neuauflagen aus Japan und den Niederlanden sind zwar stimmiger gestaltet, aber preislich beginnt der Spaß dummerweise hier natürlich erst in höheren Regionen.
Der Griff zur erwähnten Compilation schont also den Geldbeutel und man erhält nebenbei noch das Debütalbum sowie diverse Bonustracks im Gepäck. Zur Musik auf „Tumuli Shroomaroom“: Stoner Doom mit schön sattem Gitarrensound ist hier Programm, wobei die 65 Minuten einerseits gut durchlaufen, für Freunde von eindeutig wiedererkennbaren Songs aber möglicherweise zu rhythmusbetont sein könnten. Das Riff-Zelebrieren hatte die Band richtig gut drauf, der Schwerpunkt lag nicht so sehr auf prägnanten Refrains oder ausgefeilten Gitarrensoli. Das düfte unterm Strich am ehesten die KYUSS-Fraktion ansprechen, die mit Qualitätsware bedient wird, zumal sich Riffwalzen und verspieltes Herumpsychedelisieren hier gut die Waage halten.
Was den über 25 Jahre alten Longplayer gut hat altern lassen, ist die Tatsache, dass der ACRIMONY-Sound zwar eindeutig als Kind seiner Zeit identifizierbar ist, aber keineswegs wie ein längst überholtes Neunziger-Relikt den Anschluss an die Gegenwart verpasst hat. Im Doom-Stoner-Untergrund dürfte die Platte immer noch recht gut ankommen, was auch die verschiedenen Neuauflagen belegen. Die abschließende Riff-Vollbedienung (drei Songs mit beinahe 35 Minuten Länge) bringt auf den Punkt, worum es bei ACRIMONY ging.
- Stefan- 10/2024
 Es gibt Fans der Band, die das dritte Album der
im Jahr 1977 gegründeten FISCHER-Z für ein Meisterwerk halten. Ganz so
weit würde ich mit Blick auf alle Songs nicht mitgehen wollen, doch
eine wirklich bemerkenswert gute, ja herausragende Platte ist der
Gruppe um Bandkopf John Watts damit zweifellos gelungen. Wobei das
Werk, mit dem FISCHER-Z die bis dahin größte Resonanz erzielten,
zugleich eine Zäsur war: Die Wege der Band trennten sich wenig später
und Watts war nun solo unterwegs.
Es gibt Fans der Band, die das dritte Album der
im Jahr 1977 gegründeten FISCHER-Z für ein Meisterwerk halten. Ganz so
weit würde ich mit Blick auf alle Songs nicht mitgehen wollen, doch
eine wirklich bemerkenswert gute, ja herausragende Platte ist der
Gruppe um Bandkopf John Watts damit zweifellos gelungen. Wobei das
Werk, mit dem FISCHER-Z die bis dahin größte Resonanz erzielten,
zugleich eine Zäsur war: Die Wege der Band trennten sich wenig später
und Watts war nun solo unterwegs.
Doch bereits in den ausgehenden Achtzigerjahren reaktivierte er dann
die Formation wieder und es gibt sie bis heute, wobei außer John Watts
keiner der Weggefährten aus der Anfangszeit noch mit dabei ist. Doch
zurück zu „Red Skies over Paradise“: Die Scheibe fällt thematisch in
eine Zeit, in der die Zukunft vergleichbar mit der heutigen Situation
ebenfalls unsicher bis bedrohlich schien: Kriegsgefahr, Wettrüsten,
fragile politische Fronten – vieles unter ähnlichen Vorzeichen auch
2024 wieder vorhanden, wodurch die Stimmung des Albums keineswegs
veraltet wirkt oder nur für Ü50-Hörer nachvollziehbar wäre (wobei wir
alten Knacker natürlich trotzdem die Zielgruppe sind).
Die Platte beginnt mit „Berlin“, einem der eingängigsten Tracks, bei
dem das Adjektiv „poppig“ aber nicht zum Einsatz kommen mag, denn
leicht und unbeschwert klingen selbst die melodiöseren und
beschwingteren Songs dieses  Longplayers bei genauerem Hinhören nicht. Es
wäre auch irreführend, die vielleicht vom Cover auf den ersten Blick
ausgelöste, nur scheinbare Ferienstimmung mit Einflüssen aus Reggae/Ska
wie im Titeltrack so wahrzunehmen. Spätestens bei Textzeilen wie „Down
in their bunkers under the sea, men pressing buttons don’t care about
me“ wird klar, wovon hier die Rede ist und dass die „Red Skies“ kaum
weiter von schönen Sonnenuntergängen oder vergleichbaren malerischen
Farbmetaphern entfernt sein könnten.
Longplayers bei genauerem Hinhören nicht. Es
wäre auch irreführend, die vielleicht vom Cover auf den ersten Blick
ausgelöste, nur scheinbare Ferienstimmung mit Einflüssen aus Reggae/Ska
wie im Titeltrack so wahrzunehmen. Spätestens bei Textzeilen wie „Down
in their bunkers under the sea, men pressing buttons don’t care about
me“ wird klar, wovon hier die Rede ist und dass die „Red Skies“ kaum
weiter von schönen Sonnenuntergängen oder vergleichbaren malerischen
Farbmetaphern entfernt sein könnten.
Neben „Berlin“ sind auch Stücke wie „Battalions of Strangers“,
„Bathroom Scenario“, „Cruise Missiles“ oder „Multinationals Bite“ als
Höhepunkte zu nennen, wobei das ganze Album am Stück gehört einen
angenehmen Fluss aufweist und in seinem Ablauf gut zusammengestellt
wirkt. Musikalisch wird einiges an Abwechslung geboten, wobei das
Spektrum am ehesten die Fans von stilistisch freier situiertem
Post-Punk/Rock ansprechen dürfte, der es sich stilbewusst versagt hat,
in seichten Pop-Schleim abzudriften. Ach ja: Anhänger der alten NEW
MODEL ARMY sollten mal den Versuch unternehmen, den Track „Song and
Dance Brigade“ gedanklich auf deren LP „The Ghost of Cain“ von 1986 zu
verorten. Dank der musikalischen Zutaten könnte man sich die Nummer gut
als NMA-Outtake vorstellen, der zwar nicht aufs Album kam, sich aber
bestimmt auch dort wohlgefühlt hätte.
- Stefan - 10/2024

 Bleiben wir gleich bei den Briten und auch in
der gleichen Zeitspanne:
Im Jahr 1977 gründeten sich MAGAZINE rund um Sänger Howard Devoto
(ehemals BUZZCOCKS) und Gitarrist John McGeoch, der zusammen mit
einigen Bandkollegen auch bei VISAGE mitwirkte, deren größter Hit das
allseits bekannte „Fade to Grey“ wurde (wobei auch der Rest des Albums
ziemlich gelungen ausfiel und der Synthiepop-Klassiker nicht einmal der
beste Track der Scheibe war). Nach dem dritten MAGAZINE-Longplayer
wechselte McGeoch dann fest zu SIOUXSIE AND THE BANSHEES, mit denen er
ebenfalls drei Studioalben aufnahm.
Bleiben wir gleich bei den Briten und auch in
der gleichen Zeitspanne:
Im Jahr 1977 gründeten sich MAGAZINE rund um Sänger Howard Devoto
(ehemals BUZZCOCKS) und Gitarrist John McGeoch, der zusammen mit
einigen Bandkollegen auch bei VISAGE mitwirkte, deren größter Hit das
allseits bekannte „Fade to Grey“ wurde (wobei auch der Rest des Albums
ziemlich gelungen ausfiel und der Synthiepop-Klassiker nicht einmal der
beste Track der Scheibe war). Nach dem dritten MAGAZINE-Longplayer
wechselte McGeoch dann fest zu SIOUXSIE AND THE BANSHEES, mit denen er
ebenfalls drei Studioalben aufnahm.
Die vorliegende LP ist das Zweitwerk von MAGAZINE, die im Jahr zuvor
mit „Real Life“ debütiert hatten. Stilistisch wird die Band in der
Regel im Bereich Post-Punk einsortiert, was nicht unbedingt eine
aussagekräftige Kategorie darstellt. Hartes-Punkiges taucht im Grunde
nicht auf, während das Düstere des Post-Punk dagegen, siehe BAUHAUS
oder JOY DIVISION als Beispiele, eindeutig klassifizierbar ist. Der
Einstieg mit „Feed the Enemy“ steckt die Richtung ab: schleppend,
dunkel, eindringlich wären die passenden Adjektive, die sich zur
Beschreibung anbieten, wobei auch mal eher Untypisches wie ein Saxophon
zum Einsatz kommt. Bevor manchem nun Pickel oder Fangzähne wachsen:
verwässert wird der Sound dadurch nicht.
Das Grundgerüst stellt genreprägend auch hier der markante Bass,
gesanglich sind die ausdrucksstarken Vocals von Devoto ebenfalls eine
Hausnummer (Kollegen wie Peter Murphy von BAUHAUS würde ich allerdings
in einer eigenen  Liga ansiedeln). Der Sound des später als
Wundergitarristen gepriesenen McGeoch ist zunächst gar nicht so
präsent, was auch daran liegt, dass es ihm offenbar nicht darum ging,
sich als Einzelkämpfer demonstrativ in den Vordergrund zu spielen. Auf
„Juju“ von den BANSHEES klang er individuell betrachtet prägender, was
allerdings dort auch an der Produktion und an der Struktur der Songs
lag. Etwas altbacken wirken sich auf „Secondhand Daylight“ manchmal die
Anklänge an den konventionelleren Progrock aus, die das Album zur Mitte
hin leicht auszubremsen drohen, zumal es ja nun auch keine Zutaten
sind, die man beim Post-Punk in dieser Form erwarten würde.
Liga ansiedeln). Der Sound des später als
Wundergitarristen gepriesenen McGeoch ist zunächst gar nicht so
präsent, was auch daran liegt, dass es ihm offenbar nicht darum ging,
sich als Einzelkämpfer demonstrativ in den Vordergrund zu spielen. Auf
„Juju“ von den BANSHEES klang er individuell betrachtet prägender, was
allerdings dort auch an der Produktion und an der Struktur der Songs
lag. Etwas altbacken wirken sich auf „Secondhand Daylight“ manchmal die
Anklänge an den konventionelleren Progrock aus, die das Album zur Mitte
hin leicht auszubremsen drohen, zumal es ja nun auch keine Zutaten
sind, die man beim Post-Punk in dieser Form erwarten würde.
Auf der Zielgeraden entwickelt sich das Songmaterial dann wieder etwas
packender und kommt mit dem düster-schleppenden Song „Permafrost“ zu
einem gelungenen Abschluss. Auf Vinyl und CD ist die Platte aktuell
etwas teuer geworden, auch die Reissues auf CD (mit Bonustracks
ausgestattet) erzielen recht hohe Sammlerpreise. Die relativ
weitgestreute Verbreitung der Scheibe seit 1979 lässt allerdings auf
eine gewisse Nachfrage schließen und macht zukünftige Neuauflagen
einigermaßen wahrscheinlich.
- Stefan - 10/2024
 In den frühen Siebzigern lassen sich die beiden
Soundtüftler
Hans-Joachim Roedelius und Dieter Moebius auf einem sehr naturnah
gelegenen alten Hof in Forst im Weserbergland nieder (wo auch der
musikalische Wegbegleiter Michael Rother offensichtlich noch heute
lebt, wie der Blick ins Impressum seiner Website zeigt). Dort ist das
Leben viel ursprünglicher als etwa im großstädtischen Berlin, was sich
ganz folgerichtig auch im Klang der Musik widerspiegelt. Ruhig,
getragen und melodisch entwickeln CLUSTER hier ihren Sound, der auch
Kollegen international beeinflussen und sich einen Namen machen konnte.
Noch heute finden auf dem nahegelegenen Schloss Bevern Konzerte mit
elektronischer Musik statt.
In den frühen Siebzigern lassen sich die beiden
Soundtüftler
Hans-Joachim Roedelius und Dieter Moebius auf einem sehr naturnah
gelegenen alten Hof in Forst im Weserbergland nieder (wo auch der
musikalische Wegbegleiter Michael Rother offensichtlich noch heute
lebt, wie der Blick ins Impressum seiner Website zeigt). Dort ist das
Leben viel ursprünglicher als etwa im großstädtischen Berlin, was sich
ganz folgerichtig auch im Klang der Musik widerspiegelt. Ruhig,
getragen und melodisch entwickeln CLUSTER hier ihren Sound, der auch
Kollegen international beeinflussen und sich einen Namen machen konnte.
Noch heute finden auf dem nahegelegenen Schloss Bevern Konzerte mit
elektronischer Musik statt.
Die beiden Musiker waren bereits seit Jahren sehr aktiv gewesen,
zunächst aus der Berliner Szene kommend und dort mit Conrad Schnitzler
unter dem Namen KLUSTER unterwegs. Nach gemeinsamen Arbeiten mit
Michael Rother als HARMONIA (sehr geschätzt von David Bowie und Brian
Eno) nahmen CLUSTER mit „Sowiesoso“ 1976 ihr erstes Album für Sky
Records auf, nachdem sie zuvor unter anderem bei Brain veröffentlicht
hatten. Die Zusammenarbeit mit ihrem neuen Label sollte sich bis in die
frühen Achtzigerjahre erstrecken, heute fortgeführt von Bureau B, die
mittlerweile einen sehr schönen Katalog deutscher elektronischer Musik
wiederveröffentlicht haben.
 Das Album „Sowiesoso“ pendelt zwischen relativ lang
gehaltenen
Instrumentalstücken, die sich auf sieben bis acht Minuten erstrecken,
und kürzeren Tracks, die schneller auf den Punkt kommen, musikalisch
aber gar nicht mal so unterschiedlich angelegt sind. Die Musik lebt von
getragenen Melodien, die sich repetitiv fortentwickeln und Raum
benötigen, um ihre Wirkung entfalten zu können. Bemerkenswert ist
dabei, dass CLUSTER sich nicht in groß angelegten „Flächen“ ausbreiten
mussten, also in Stücken weit jenseits der 20-Minuten-Grenze. Auch die
kleineren Formen, musikalische Miniaturen vielleicht, offenbaren
unmittelbar die Handschrift des Duos, das auf „Sowiesoso“ einen warmen
Sound präsentiert, der allerdings nicht zum locker-flockigen
Naturkitsch wird. Wie das LP-Cover ist auch die Musik in ihrer Stimmung
bisweilen durchaus geheimnisvoll.
Das Album „Sowiesoso“ pendelt zwischen relativ lang
gehaltenen
Instrumentalstücken, die sich auf sieben bis acht Minuten erstrecken,
und kürzeren Tracks, die schneller auf den Punkt kommen, musikalisch
aber gar nicht mal so unterschiedlich angelegt sind. Die Musik lebt von
getragenen Melodien, die sich repetitiv fortentwickeln und Raum
benötigen, um ihre Wirkung entfalten zu können. Bemerkenswert ist
dabei, dass CLUSTER sich nicht in groß angelegten „Flächen“ ausbreiten
mussten, also in Stücken weit jenseits der 20-Minuten-Grenze. Auch die
kleineren Formen, musikalische Miniaturen vielleicht, offenbaren
unmittelbar die Handschrift des Duos, das auf „Sowiesoso“ einen warmen
Sound präsentiert, der allerdings nicht zum locker-flockigen
Naturkitsch wird. Wie das LP-Cover ist auch die Musik in ihrer Stimmung
bisweilen durchaus geheimnisvoll.
Das naturverbundene Leben in Forst ist musikalisch dabei zum Greifen
nah, vieles klingt in sich ruhend und in angenehmer Weise harmonisch im
Fluss. Das Klischee von den Krautrockern, die sich auf den ländlichen
Bauernhof zurückziehen und sich dort in irgendwelchen Experimenten
verlieren, könnte (falls jemand CLUSTER damit überhaupt in Verbindung
bringen möchte) unzutreffender nicht sein. „Sowiesoso“ klingt wie sehr
gefühlsbetonte Musik von Menschen, die im künstlerischen Kern
angekommen sind und sich bzw. ihrer Umwelt nichts beweisen müssen in
Form ausgestellter Virtuosität mit schier endlosen Soli oder
vergleichbarem Kram, mit dem Eindruck geschindet werden soll. Hier
findet im ursprünglichen Sinn des Wortes „entspannende“ Musik statt,
die völlig losgelöst von ihrer Entstehungszeit auch fast 50 Jahre
später noch immer funktioniert, wie Roedelius im Interview mit dem
Deutschlandfunk feststellte: „Wir sind unsere eigene Tonsprache …
deswegen wird unsere Musik auch noch in 100 Jahren gehört werden.“
- Stefan - 10/2024

 Die Existenz eines Horrorfilm-Klassikers
namens HALLOWEEN von 1978 und all seiner Sequels muss man sicher nicht
mehr besonders erläutern, er gehört längst zur Popkultur und das
weltweit. Ein damals eher ungeliebter und erst mit gehöriger Verspätung
geschätzter Vertreter der Reihe ist der dritte Teil aus dem Jahr 1982.
Bemerkenswert vor allem deshalb, weil er für einen Horror-Franchise aus
den Achtzigern bereits zu einem ausgesprochen frühen Zeitpunkt etwas
schier Unerhörtes tat: Die böse Hauptfigur in Gestalt von Michael Myers
hat hier keine Bedeutung mehr.
Die Existenz eines Horrorfilm-Klassikers
namens HALLOWEEN von 1978 und all seiner Sequels muss man sicher nicht
mehr besonders erläutern, er gehört längst zur Popkultur und das
weltweit. Ein damals eher ungeliebter und erst mit gehöriger Verspätung
geschätzter Vertreter der Reihe ist der dritte Teil aus dem Jahr 1982.
Bemerkenswert vor allem deshalb, weil er für einen Horror-Franchise aus
den Achtzigern bereits zu einem ausgesprochen frühen Zeitpunkt etwas
schier Unerhörtes tat: Die böse Hauptfigur in Gestalt von Michael Myers
hat hier keine Bedeutung mehr.
Das irritierte die Fangemeinde, die einen Charakter wie diesen ähnlich
wie im Fall seiner Kollegen Jason Voorhees (FREITAG DER 13.) und Freddy
Krueger (A NIGHTMARE ON ELM STREET) als für die Dramaturgie
unverzichtbares Inventar betrachtete. John Carpenter, der zwar nur beim
ersten Teil Regie geführt, aber immer noch eine maßgebliche Funktion
hatte, plante sogar, eine Filmreihe ins Leben zu rufen, die mit jedem
weiteren Teil ähnlich eigene Wege gehen sollte.
Der damals eher überschaubare kommerzielle Erfolg von Teil 3 machte
diese Pläne zunichte, man kehrte auf gewohntes Terrain zurück und nahm
Michael Myers wieder ins Boot. So blieb der durchaus risikofreudige
Film ein Solitär, der sich erst viele Jahre später größerer Beliebtheit
erfreute. In der Rückschau strahlt er zwar auch nicht makellos, aber
ein bemerkenswert gutes und originelles Werk ist er dennoch. Produzent
John Carpenter und Alan Howarth veredelten den Film mit einem Score,
der auch für sich genommen, ohne filmische Begleitung, bestehen kann.
Im Gegensatz etwa zur Musik des ersten Teils (ebenfalls von Carpenter)
klingt der Soundtrack hörbar dunkler und bedrohlicher, arbeitet mehr
mit düster anschwellenden denn mit offen nervenaufreibenden Elementen.
Das funktioniert auf sehr wirksame Weise und stellt unter Beweis, wie
wichtig gerade bei einem solchen Stoff die Auswahl der passenden
Filmmusik nun einmal ist.

Im vorliegenden Fall passt sie natürlich
(aber nicht nur) speziell an
Halloween wie die Faust aufs Auge und man verzeiht dem Score die
ziemlich nervtötende Nummer „Halloween TV Commercial“, denn auch diese
erfüllt ihre Zweck: Ein Spielwarenkonzern will seine diabolischen
Halloween-Masken an die junge Kundschaft bringen und setzt zu diesem
Zweck in Dauerberieselung eine fürchterliche Kinderliednummer ein,
welche die Erwachsenen schier zur Verzweiflung bringt. Wer’s gar nicht
mehr aushält, kann ja seinen CD-Player per Programmierung den Track
gnädig überspringen lassen. Horribel sieht es leider auch mit Blick auf
die Preisgestaltung aus, denn aktuell dürften hohe Sammlerpreise fällig
werden, sollte jemand die Anschaffung des hörenswerten Soundtracks ins
Auge gefasst haben und da reden wir noch nicht einmal nur von alten
Vinyl-LPs aus dem Achtzigern. Rätselhaft, warum etwa eine US-CD von
2007 unbedingt auf sehr knapp bemessene 1000 Exemplare beschränkt sein
musste, so tot kann doch der physische Tonträgermarkt damals noch nicht
gewesen sein.
- Stefan - 10/2024
 Künstler und Kunst stellen oftmals komplexe Fragen: Die
Trennung von beiden Seiten ist nicht so einfach zu bewerkstelligen und
doch erscheint sie nicht selten angenehm, wenn Künstler menschlich
durch Handlungen oder Ideologien Abwehr auslösen, während ihre Kunst zu
unterhalten oder zu faszinieren vermag. Für die einen ist es Richard
Wagner, für andere Roman Polanski: schwierige Individuen, mit großen
Werken gesegnet, die aber wegen des biographischen Hintergrunds auf
Ablehnung stoßen. Im Metalbereich können das die Kirchenanzünder aus
Norwegen sein oder vermeintliche Ikonen, die nach langen Jahren der
Selbstradikalisierung zu Staatsfeinden werden und das US-Kapitol
stürmen.
Künstler und Kunst stellen oftmals komplexe Fragen: Die
Trennung von beiden Seiten ist nicht so einfach zu bewerkstelligen und
doch erscheint sie nicht selten angenehm, wenn Künstler menschlich
durch Handlungen oder Ideologien Abwehr auslösen, während ihre Kunst zu
unterhalten oder zu faszinieren vermag. Für die einen ist es Richard
Wagner, für andere Roman Polanski: schwierige Individuen, mit großen
Werken gesegnet, die aber wegen des biographischen Hintergrunds auf
Ablehnung stoßen. Im Metalbereich können das die Kirchenanzünder aus
Norwegen sein oder vermeintliche Ikonen, die nach langen Jahren der
Selbstradikalisierung zu Staatsfeinden werden und das US-Kapitol
stürmen.
Das Beiseiteschieben aller Bedenken zugunsten des Kunstwerks mag zwar
dem unverfälschten Kunstgenuss dienlich sein, befördert aber auch die
unangenehmen Aspekte von Entstehung und Wirkungsgeschichte ins Abseits,
nach dem Motto: Mir doch egal, was da sonst noch passiert ist. Selbst
bei an sich unverdächtigen Akteuren wie TRUST aus Frankreich, denen man
keine echte Verherrlichung von Mördern wird nachsagen können, ist das
Thema Jacques Mesrine (ein mehrfacher Mörder immerhin) nicht frei von
der Gefahr der Idealisierung. Auch bei Bobby Beausoleil, der seit
Jahrzehnten wegen Mordes inhaftiert ist, lässt sich das Verbrechen
(begangen als Teil des Charles-Manson-Umfeldes) nicht ausblenden, wurde
doch die hier zu besprechende Musik im Knast eingespielt.

Der Kurzfilm „Lucifer Rising“ von Avantgardefilmer Kenneth Anger hat eine bewegte Geschichte hinter sich, bevor er 1980 endlich in einer finalen Fassung erscheinen konnte. Bobby Beausoleil hatte ursprünglich sogar eine tragende Rolle darin gespielt, bevor es zum Konflikt mit Anger kam, der sich danach wiederum auch mit Jimmy Page überwarf, der im Film zwar noch kurz zu sehen ist, während die von ihm komponierte Musik von Anger als Soundtrack abgelehnt wurde (weitere Informationen liefert der umfangreiche englische Wikipedia-Eintrag, den zu erläutern an dieser Stelle definitiv viel zu weit führen würde). Der Bruch Angers mit Bobby Beausoleil war nicht von ewiger Dauer, denn nun bot sich der Inhaftierte an, seinerseits eine neue Filmmusik für „Lucifer Rising“ zu komponieren, was ihm auch hinter Gittern erlaubt wurde.

So reizvoll für Fans von Led Zeppelin und Jimmy Page die
ursprünglichen Aufnahmen sein mögen, offenbart die Vertonung durch
Beausoleils „Freedom Orchestra“ ein Erlebnis, welches perfekt zu den
Bildern passt. Über Jahre hinweg an verschiedenen „magischen“ Plätzen
wie Stonehenge, den Externsteinen im Teutoburger Wald oder in Ägypten
gefilmt, entwickelt der Film von den ersten Einstellungen an einen
unwiderstehlichen Sog, der auch viel mit der Musik zu tun hat. Der
Score schöpft aus Quellen wie sphärischem, psychedelischem Progressive
Rock und melodiösen elektronischen Klängen, das Resultat ist
außergewöhnlich.
Die Symbiose aus Bildern und Musik läuft ab wie ein Trip, der sich
konventioneller Dramaturgie verweigert und wie ein bizarrer Stummfilm
genossen werden sollte. Vom Mainstream weit entfernt, entwickelte
„Lucifer Rising“ dennoch beachtliche Bekanntheit, die ihn bis ins
deutsche Kulturfernsehen führte (der WDR drehte schon in den Siebzigern
eine Anger-Dokumentation und seine Filme waren mehrmals bei 3sat zu
sehen). Die Musik ist auf CD und Vinyl des Öfteren wiederveröffentlicht
worden, was auch für die Version von Jimmy Page gilt, der seinen Score
nach diversen Bootlegs offiziell als LP über seine Website auf den
Markt brachte.
- Stefan - 11/2024

 Was
diese Band nicht alles an verschiedenen Stilrichtungen bedient haben
soll: Discogs bietet gleich fünf Kategorien an. Psychedelic Rock, Indie
Rock, Ethereal, Glam und Dream Pop stehen zur Auswahl. Und wenn man
sich die Beschreibungen ansieht, tauchen tatsächlich Elemente daraus in
der Musik von OPAL auf. Sehr umfangreich ist das Gesamtschaffen nicht:
ein Album, zwei Singles und eine Compilation mit frühem Material, nicht
einfach und vor allem nicht halbwegs preisgünstig zu bekommen.
Was
diese Band nicht alles an verschiedenen Stilrichtungen bedient haben
soll: Discogs bietet gleich fünf Kategorien an. Psychedelic Rock, Indie
Rock, Ethereal, Glam und Dream Pop stehen zur Auswahl. Und wenn man
sich die Beschreibungen ansieht, tauchen tatsächlich Elemente daraus in
der Musik von OPAL auf. Sehr umfangreich ist das Gesamtschaffen nicht:
ein Album, zwei Singles und eine Compilation mit frühem Material, nicht
einfach und vor allem nicht halbwegs preisgünstig zu bekommen.
Gegenüber den frühen Aufnahmen klingt die 1987er LP schrammeliger und
etwas gitarrenlastiger, dennoch überrascht die Veröffentlichung auf SST
Records. Das Label war damals ja eher in härteren Gefilden unterwegs
und hatte Bands wie BLACK FLAG, SOUNDGARDEN, HÜSKER DÜ, BAD BRAINS oder
SAINT VITUS im Repertoire. Aber vielleicht war es gerade diese auf den
ersten Blick unpassend erscheinende musikalische Umgebung, die OPAL
(wenn auch nur für einen begrenzten Interessentenzirkel) hervortreten
und glänzen ließ.
Einflüsse aus den Sechzigern, aus dem psychedelischen Sound jener Zeit,
sind auf „Happy Nightmare Baby“ ohne größere Schwierigkeiten
wiederzufinden. Die DOORS bieten sich da am ehesten an, wobei man sich
das Ganze nicht als 1:1-Wiederkehr von Jim Morrison & Co.
vorstellen sollte. OPAL waren in ihrem gebremsten Sound, der ohne
exaltierte Ausbrüche und vordergründige „große Momente“ auskommt, auf
einem doch sehr individuellen Pfad unterwegs. Stellenweise fast schon
widerwillig wirkend kriecht das Album durch die 42 Minuten, als müsse
die Musik erst dazu überredet werden, sich in das Genre „Rock“
vorzuarbeiten. Nein, hier findet man eigentlich nichts von dem, was die
Autoren von Plattenfirmen-Infomaterial damit meinen, wenn jemand
„straight nach vorne losrockt“ oder „mit geballter Gitarren-Power
nichts anbrennen lässt“.

Mit stetigem Midtempo als verlässlichem
Fundament entwickeln OPAL dennoch eine Sogwirkung, die ihren Reiz hat.
Gerade weil hier niemand was überstürzt: einfach immer geradeaus
fahren, dritter oder vierter Gang reicht, wir haben Zeit. Wer dabei auf
einen schnelleren Part, auf eine gelegentlich mal auftauchende
Uptempo-Enklave hofft: Pech gehabt, da kommt nix. Am besten
funktioniert das bei einem fabelhaften Song wie „Supernova“, der die
OPALschen Stärken auf den Punkt bringt, wobei auch „Siamese Trap“ oder
der swingende Titeltrack als Anspieltipps zu empfehlen sind. Lässt man
das Album einige Male durchlaufen, ist problemlos nachvollziehbar,
warum eine kleine aber feine Fangemeinde die Scheibe sehr schätzt.
Leider wird es auch hier wieder saumäßig teuer, sollte man das Kleinod
als Tonträger erstehen wollen. Eine Neuauflage wurde zurückgezogen,
nach den Originalen aus den Achtzigern zu fahnden kann kostspielig
werden, wobei „Happy Nightmare Baby“ seinerzeit sogar als deutsche
LP-Pressung über Rough Trade erschienen war.
- Stefan - 11/2024
 Ganze vier Jahrzehnte gibt es die Schweden schon
und sie haben es gerade mal auf fünf Platten gebracht, kleinere
Veröffentlichungen wie ein Demo oder eine Single nicht mitgerechnet.
Für eine gewisse Bekanntheit reichte es trotzdem, immerhin haben Bands
wie ENTOMBED oder PARADISE LOST gelegentlich eine Nummer von STILLBORN
gecovert. Jedoch lagen auch 15 Jahre Pause zwischen dem Longplayer von
1992 und dem Comeback-Album „Nocturnals“ von 2017. Besonders eilig
scheint es die Band nicht zu haben, denn bis „Netherworlds“ (im Sommer
2024 erschienen) vergingen immerhin ebenfalls lange sieben Jahre.
Ganze vier Jahrzehnte gibt es die Schweden schon
und sie haben es gerade mal auf fünf Platten gebracht, kleinere
Veröffentlichungen wie ein Demo oder eine Single nicht mitgerechnet.
Für eine gewisse Bekanntheit reichte es trotzdem, immerhin haben Bands
wie ENTOMBED oder PARADISE LOST gelegentlich eine Nummer von STILLBORN
gecovert. Jedoch lagen auch 15 Jahre Pause zwischen dem Longplayer von
1992 und dem Comeback-Album „Nocturnals“ von 2017. Besonders eilig
scheint es die Band nicht zu haben, denn bis „Netherworlds“ (im Sommer
2024 erschienen) vergingen immerhin ebenfalls lange sieben Jahre.
Auf dem vorliegenden Album spielen STILLBORN eine gefällige Mixtur aus
Doom Metal und Gothic-Metal-Schlagseite, wobei der Doom schon den
dominanteren Part einnimmt. Leicht exzentrisch nimmt sich der Gesang
aus, der bisweilen auf Kritik stößt, da die Grabesstimme auf den ersten
Eindruck durchaus etwas schrullig klingt, so als hätten gesangliche
Elemente aus der Erbmasse von Peter Steele sich mit Günter Wewel
(bekannt aus „Kein schöner Land“ in der ARD) zum gemeinsamen Musizieren
getroffen. Aber wir wollen nicht lästern oder gar den Begriff
„Knödeltenor“ bemühen, denn markant tönt der Mann am Mikro zweifelsohne
und verleiht den Songs im Rahmen seiner Möglichkeiten ihren
Wiedererkennungswert.
Und was macht die Musik? Die ist meist sehr riffbetont und setzt auf
das Stilmittel der Wiederholung, was seine Wirkung entfaltet, denn gute
Riffs können die vier Schweden. Bei Songs wie dem Eröffnungstrack
„1917“, „The Animal within“ oder „Fata Morgana“ spielt diese
Songwriting-Strategie ihre Stärken aus, zumal auch der wuchtig
produzierte Sound mit zwei Gitarren nach Kräften mithilft. Recht
simpel, aber auch ziemlich eingängig sind die Melodien wie im Refrain
von „Oblivion reloaded“, bei denen sich Elemente offenbaren, wie man
sie auch im Gothic Metal der Neunziger wiederfinden könnte. Das kommt
alles recht schnell und gut auf den Punkt, trägt aber – zumindest bei
einigen Stücken – auch einen gewissen Abnutzungseffekt in sich.
Sound mit zwei Gitarren nach Kräften mithilft. Recht
simpel, aber auch ziemlich eingängig sind die Melodien wie im Refrain
von „Oblivion reloaded“, bei denen sich Elemente offenbaren, wie man
sie auch im Gothic Metal der Neunziger wiederfinden könnte. Das kommt
alles recht schnell und gut auf den Punkt, trägt aber – zumindest bei
einigen Stücken – auch einen gewissen Abnutzungseffekt in sich.
Die meisten Songs sind in ihrer Struktur (offenbar gewollt) nicht mit
dem Willen zur Abwechslung durchkomponiert. Da gibt es keine
überraschenden Wendungen, musikalischen Nebengleise oder andere
Auffälligkeiten. Riffs und Themen werden konsequent bis zum Ende
beibehalten, gerne auch öfter aufgegriffen und darin liegt manchmal die
Schwäche im Songwriting, die zugleich das prägende Stilmittel
darstellt. Die Wiederholungen kommen bisweilen den einen Schritt zu
oft, was aber mit Blick auf die Gesamtleistung nicht allzu negativ in
die Wertung einfließen soll, denn die Platte überzeugt mit guten bis
sehr guten Gitarrenriffs, die sich als Motor mit ordentlicher Zugkraft
erweisen. Die besseren Stücke (und das sind so einige) bieten
gutklassigen Doom mit enormer Eingängigkeit und was die teilweise etwas
bremsenden Wiederholungen angeht, wollen wir mal auf Hochkaräter wie
IRON MAIDEN verweisen. Dort wird dieses Stilmittel ja gerne derart
ausgereizt, dass die Songs auf die Zehn-Minuten-Grenze zusteuern, was
ihnen definitiv mehr schadet als nützt, gleichwohl in Teilen der
Fachpresse trotzdem mit Top-Noten gefeiert wird. Fazit: STILLBORN mögen
meinetwegen aus der „Zweiten Garnitur“ stammen, haben aber in ihrem
einfach strukturierten Doom mit kauzigem Gesang dennoch eine eigene
Identität entwickelt, das sollte eine Empfehlung allemal wert
sein.
- Stefan - 11/2024

 Nach vier Demotapes ab 1990 brachten die Finnen
UNHOLY im Jahr 1993
schließlich ihr Erstlingswerk heraus, garniert mit düster-schwerem
Metal, der sich in der Schnittmenge zwischen Death und Doom
bewegte. Was die Sache eigenartig werden ließ, war das Erscheinungsbild
der Band, die sich optisch teilweise über Corpsepaint mit einer Aura im
Stil des Black Metal umgab, was sie dann wieder völlig über den Haufen
warf, wenn man sich andere Bandfotos ansieht. Bei der Musik ergab sich
ein ähnlicher Effekt: Auch wenn der Extreme Metal damals gerade in
voller Blüte stand und UNHOLY dadurch wohl auch ihren Plattendeal
bekamen, passen sie kaum in eine der seinerzeit gängigen Schubladen.
Nach vier Demotapes ab 1990 brachten die Finnen
UNHOLY im Jahr 1993
schließlich ihr Erstlingswerk heraus, garniert mit düster-schwerem
Metal, der sich in der Schnittmenge zwischen Death und Doom
bewegte. Was die Sache eigenartig werden ließ, war das Erscheinungsbild
der Band, die sich optisch teilweise über Corpsepaint mit einer Aura im
Stil des Black Metal umgab, was sie dann wieder völlig über den Haufen
warf, wenn man sich andere Bandfotos ansieht. Bei der Musik ergab sich
ein ähnlicher Effekt: Auch wenn der Extreme Metal damals gerade in
voller Blüte stand und UNHOLY dadurch wohl auch ihren Plattendeal
bekamen, passen sie kaum in eine der seinerzeit gängigen Schubladen.
Für den Todesmetalljünger gab es permanente Entschleunigung, was dem gängigen Hang des Death Metal zum Geschwindigkeitsrausch maximal widersprach. Der Growl-Gesang zieht sich tiefergelegt und gequält durch die Stücke, streut aber auf diesem Weg immer wieder gesangliche Abweichungen ein. Auch der geneigte Doom-Freund könnte eventuell reserviert auf das Gebotene reagieren, denn langsam ist das Material zwar, aber auch verschroben und nicht unbedingt leicht zugänglich, wenn man traditionelle Doom-Klänge bevorzugt. Düstere Keyboards und Klargesang wie im zweiten Track „Gray Blow“ runden den irritierenden UNHOLY-Sound ab.
Ist das Ganze also eher ein konfuser Stilmix, der nicht auf den Punkt kommt? Keineswegs, denn die Band ist konsequent in ihrem Stilwillen und erschafft eine Klangwelt, die zwar anstrengend ist, aber auch über eine Strecke von über 60 Minuten funktioniert. Man darf halt nur nichts erwarten, das im konventionellen Sinne als mitreißend gelten könnte, das war offenbar beim Songwriting in der Kiste mit den verbotenen Stilmitteln gelandet. Die Songs schleppen sich einer nach dem anderen düster dahin, sind nicht unbedingt abwechslungsreich, schnellere Passagen lassen sich nur selten ausfindig machen. Doch darin liegt auch ein gewisser Reiz und die seltsamen stilfremden Einsprengsel machen das Album zu einer interessanten Angelegenheit.

In Verbindung mit dem faszinierenden Cover, das eine Olmeken-Figur aus Südamerika zeigt und den rätselhaften Charakter der Musik sehr gelungen unterstreicht, ist „From the Shadows“ mit seinen fast durchgehend langen Stücken (sieben bis acht Minuten) nichts für den schnellen Genuss. Wer es knackiger und flott verpackt schätzt, wird hier wohl bald die Segel streichen und das ist auch nachvollziehbar. UNHOLY kreisen immer wieder um ihre musikalischen Themen, als befände man sich gerade in einer Metal-Version einer nirgendwohin führenden Escher-Grafik. Auch wenn der Death Metal mehr als nur gestreift wird, bleiben bangerfreundliche „Klopper“ hier komplett außen vor. Damit landete man seinerzeit zwischen den Stühlen, zielgruppengerechtes Musizieren mit wenig Risiko ginge tatsächlich anders. Wer mit dem Zelebrieren von ausgewalzter Langsamkeit jedoch etwas anfangen kann, könnte hier ein echtes „Winter-Album“ für sich entdecken.
- Stefan - 12/2024
