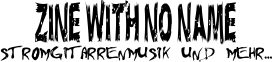

"Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder,
und der Herbst beginnt. Rote Blätter fallen,
graue Nebel wallen, kühler weht der Wind."
(Franz Schubert)
 Es wäre vermessen, zu behaupten,
dass PAGAN ALTAR in den (mit langer Unterbrechung) vier Jahrzehnten
ihres Bestehens eine wahre Flut an Veröffentlichungen produziert
hätten. Das erste Album erschien 20 Jahre nach der Bandgründung, danach
folgte die aktivste Phase der Band: Mitte der 2000er Jahre kamen drei
Longplayer auf den Markt, gefolgt von einer Zeit, in der PAGAN ALTAR
einen schweren Verlust hinnehmen mussten. Sänger Terry Jones starb 2015
an einer Krebserkrankung, die Veröffentlichung des vorliegenden Albums
erlebte er nicht mehr. Die Band um seinen Sohn, den Gitarristen Alan
Jones, besteht bis heute weiter, um das auf "The Room of Shadows"
abgeschlossene Erbe zu bewahren, das mit teils hymnischen Reviews
gefeiert wurde.
Es wäre vermessen, zu behaupten,
dass PAGAN ALTAR in den (mit langer Unterbrechung) vier Jahrzehnten
ihres Bestehens eine wahre Flut an Veröffentlichungen produziert
hätten. Das erste Album erschien 20 Jahre nach der Bandgründung, danach
folgte die aktivste Phase der Band: Mitte der 2000er Jahre kamen drei
Longplayer auf den Markt, gefolgt von einer Zeit, in der PAGAN ALTAR
einen schweren Verlust hinnehmen mussten. Sänger Terry Jones starb 2015
an einer Krebserkrankung, die Veröffentlichung des vorliegenden Albums
erlebte er nicht mehr. Die Band um seinen Sohn, den Gitarristen Alan
Jones, besteht bis heute weiter, um das auf "The Room of Shadows"
abgeschlossene Erbe zu bewahren, das mit teils hymnischen Reviews
gefeiert wurde.
Da stellt sich natürlich die Frage, ob diese Lobpreisungen nicht vielleicht doch Ausdruck übersteigerter Fanliebe waren. Nicht selten neigt man ja dazu, im ersten Gefühlsüberschwang Höchstnoten zu verteilen - so wie andere Zeitgenossen vor einer Wahl bereitwillig in die Schatulle mit den Steuergeldern greifen. Aber auch über ein Jahr nach seiner Veröffentlichung ist "The Room of Shadows" immer noch ein wirklich herausragender Meilenstein im Epic Doom Metal, der nichts von seiner überragenden Qualität eingebüßt hat.

PAGAN ALTAR haben mit diesem Album ein in sich geschlossenes Werk geschaffen, das vom Coverartwork bis zur Musik als im Grunde makellos gelten kann. Auch wenn es die anderen Songs nicht abwerten soll, so ist es doch der Doppelpack "Dance of the Vampires" zusammen mit dem Titelstück, der die Stärken der Band zum Ausdruck bringt: eine kraftvolle, aber natürlich klingende und nicht zu moderne Produktion, der leicht nasale Gesang von Terry Jones, die mitreißenden Riffs und Soli - hier stimmt alles. Wobei der Begriff Doom Metal für besonders linientreue Genreverfechter stellenweise vielleicht nicht ganz zutreffend klingen mag, denn bisweilen drücken PAGAN ALTAR durchaus auch mal aufs Gaspedal.
Über allem schwebt jedoch eine ergreifende Feierlichkeit, die auch (frühere) Größen wie CANDLEMASS nur an besonderen Tagen hinbekommen haben. Für einen besinnlichen Ausklang sorgt die akustische Ballade "After Forever", mit eineinhalb Minuten eher ein Epilog denn ein kompletter Song und doch passend als Abschluss für ein Album, das lange nachwirken wird. Es mag angesichts der medialen Informations- und Veröffentlichungsflut eine sicher voreilige Vermutung sein, doch von "The Room of Shadows" wird man auch in 10 oder 20 Jahren noch sprechen, selbst wenn größerer kommerzieller Erfolg ausbleiben sollte.
- Stefan - 10/2018
 Auch wer als geneigter Hörer im
Doom- oder Postrock-Genre eher wohlwollend und nicht überkritisch
unterwegs ist, wird eine gewisse Übersättigung kaum leugnen können.
Dank der weltweiten Verfügbarkeit ist binnen weniger Minuten Musik im
Haus, die man früher entweder nie wahrgenommen hätte oder erst nach
Wochen mittels getauschter Kassettenkopien in Händen halten konnte. Die
Welt rückt zusammen - so würde es das Floskelteufelchen in mir
formulieren, wobei sich die Frage stellt, ob nicht durch das
gegenseitige Beeinflussen bestimmte regionale Besonderheiten einfach
rausgekegelt werden. Anders gesagt: Da kann die Postrock-Combo aus
Singapur schon mal so klingen wie ihre Kollegen aus Kanada, sodass man
auf den ersten oder auch zweiten Eindruck keinen Unterschied hört - was
nicht unbedingt immer ein Vorteil sein muss.
Auch wer als geneigter Hörer im
Doom- oder Postrock-Genre eher wohlwollend und nicht überkritisch
unterwegs ist, wird eine gewisse Übersättigung kaum leugnen können.
Dank der weltweiten Verfügbarkeit ist binnen weniger Minuten Musik im
Haus, die man früher entweder nie wahrgenommen hätte oder erst nach
Wochen mittels getauschter Kassettenkopien in Händen halten konnte. Die
Welt rückt zusammen - so würde es das Floskelteufelchen in mir
formulieren, wobei sich die Frage stellt, ob nicht durch das
gegenseitige Beeinflussen bestimmte regionale Besonderheiten einfach
rausgekegelt werden. Anders gesagt: Da kann die Postrock-Combo aus
Singapur schon mal so klingen wie ihre Kollegen aus Kanada, sodass man
auf den ersten oder auch zweiten Eindruck keinen Unterschied hört - was
nicht unbedingt immer ein Vorteil sein muss.
Der erste Eindruck war es auch, der bei OM leichte Irritationen auslöste: Sind da womöglich irgendwelche religiös verstrahlten Esoteriker am Werk? Der Blick auf die beteiligten Musiker (unter den ehemaligen und noch aktiven Mitgliedern auch solche aus der Besetzung von ASBESTOSDEATH und SLEEP) ließ das Interesse jedoch schnell größer werden. OM bewegen sich zwar durchaus in Doom-Randbereichen, schaffen dadurch Landeplätze für Fans aus diesem Genre, präsentieren daneben aber auch orientalisch oder asiatisch Klingendes wie das einleitende Stück "Addis", das mich in seiner Stimmung ein wenig an den HYBRYDS-Track "Hamyanna El Caballo" auf einem Peaceville-Sampler aus den frühen Neunzigern erinnert.
Auch wenn OM über den gesamten Longplayer eine meditative Aura verbreiten, versinken sie keineswegs in einschläfernder Monotonie. Brummelnder Bass und Doom-Riffs haben also schon ihren Platz, jedoch fehlt hier eine betont düstere oder gar okkulte Aura. Geduld ist freilich gefragt, denn die Tracks 3 bis 5 gehen erst nach mindestens zehn Minuten Spielzeit über die Ziellinie. Dem Trio gelingt es, das Prinzip der Wiederholung nicht über Gebühr zu strapazieren, sodass die Gratwanderung zwischen Intensität und möglicher Langeweile über die knappe Dreiviertelstunde, die das Album einnimmt, als gelungen bezeichnet werden darf.

Der OM-Sound konzentriert in seiner Basis auf die zunächst vielleicht eher spartanisch anmutenden Elemente Bass, Schlagzeug und Gesang. Nicht nur auf diesem Album öffnet er sich aber auch anderen Instrumenten, etwa aus dem Percussion-Bereich, aber auch akzentuiert eingesetzten Streichern (was aber nicht zu einem süßlichen Zuckerguss aus Kitschgeigen führt, die Band geht da schon songdienlich und dezent vor).
Je näher "Advaitic Songs" seinem Ende kommt, desto mehr verlieren sich die Elemente aus Rock und Doom, was Gitarrensüchtige möglicherweise abschrecken wird. Andererseits sorgt die hypnotische Aura der Musik dafür, dass man das Album eher komplett durchhört als auf einzelne Tracks zu achten. Was belegt, dass sich OM mit ihrem durchaus originellen Ansatz eine eigene Nische und damit einen Wiedererkennungswert geschaffen haben - nicht ganz so einfach angesichts einer schier erschlagenden Fülle an interessanten Bands.
- Stefan - 10/2018



Im vergangenen Jahr hatten wir die Russen HUMAN TETRIS zu Gast in der Herbstmusik, daran können wir mit dieser Band gleich direkt anschließen. Auch BRANDENBURG aus Moskau bewegen sich im Postpunk-beeinflussten Indiesektor, Fans von INTERPOL und Konsorten (natürlich auch traditionsbewusste Joy-Division-Anhänger) dürften sich daher besonders angesprochen fühlen. Der Sound ist geradezu ideal herbstgeeignet, sehr ruhig und von Melancholie durchzogen, aber auch mit einem treibenden, dominanten Bass ausgestattet, der hier deutlich aktiver eingesetzt wird statt nur begleitender Rhythmusgeber im Hintergrund zu sein.
Der Erstling "Empires will fall" von 2013 dauert nur eine halbe Stunde, was aber kein Nachteil ist, denn dadurch bleibt das Album kompakt und vermeidet es, mit zu vielen Nummern künstlich aufgeblasen dann phasenweise zu austauschbar zu klingen. BRANDENBURG sind (noch) nicht die großen Songschreiber, die beinahe jedem Stück einen vollkommen unverwechselbaren Charakter mitzugeben in der Lage sind, sie transportieren ihre Qualitäten zu einem beträchtlichen Teil auch über die damit erschaffene Stimmung.
Was aber nicht heißen soll, dass sich keine bemerkenswerten Einzelleistungen auf dem Album finden würden. Das großartig beginnende "Get rid of you" ist sicher das markanteste Stück, aber auch die abschließenden "Seven" und "A lovely Place" müssen sich da nicht verstecken. Die 2016 veröffentlichte digitale EP "Cold Nights" behält einerseits die stilistische Grundausrichtung bei, ist aber zugleich offener und etwas leichter im Sound. Im letzten Stück "That's not the Point at all" kommt sogar ein Saxophon zum Einsatz (für manche ein "verbotenes" Instrument in der Rockmusik, aber da wollen wir mal nicht so streng sein).
Ein Highlight ist "Look at the Sky", wieder um eine dominierende, sich durch den Song ziehende Basslinie aufgebaut, ergänzt mit melodischen Gitarrenakzenten. BRANDENBURG haben damit ihr Repertoire schon recht gut definiert, allerdings auch relativ beschränkt. Soll heißen: Eine allzu experimentierfreudige Ausgangsbasis ist dieser Bandsound nicht oder wird zumindest dafür nicht genutzt, sodass es immer auf die jeweilige Tagesform hinausläuft. Mit den beiden vorliegenden Veröffentlichungen haben BRANDENBURG jedenfalls interessante Musik im Gepäck, die gerade in der aktuellen Jahreszeit sehr gut funktioniert.
Die Band ist auf etlichen Online-Plattformen unterwegs, unter anderem auf YouTube, wo neben einzelnen Clips auch das komplette Album "Empires will fall" zum Probehören bereitsteht.
- Stefan - 10/2018
 Obwohl er nur ein einziges eigenes
Album aufnahm, war Wolfgang Riechmann in der Düsseldorfer Musikszene
gut vernetzt. Mit den späteren KRAFTWERK- bzw. NEU!-Musikern Wolfgang
Flür und Michael Rother hatte Riechmann unter anderem in der Band
SPIRITS OF SOUND gespielt. Mit der Gruppe STREETMARK hatte er mit dem
vielbeachteten Produzenten Conny Plank (KRAFTWERK, DAF, ULTRAVOX)
zusammengearbeitet. In dieser Klangumgebung, im deutschen Elektronik-
und Rocksound der Siebzigerjahre, entstanden Riechmanns Kompositionen
für sein Soloalbum "Wunderbar", das zugleich sein Vermächtnis wurde.
Obwohl er nur ein einziges eigenes
Album aufnahm, war Wolfgang Riechmann in der Düsseldorfer Musikszene
gut vernetzt. Mit den späteren KRAFTWERK- bzw. NEU!-Musikern Wolfgang
Flür und Michael Rother hatte Riechmann unter anderem in der Band
SPIRITS OF SOUND gespielt. Mit der Gruppe STREETMARK hatte er mit dem
vielbeachteten Produzenten Conny Plank (KRAFTWERK, DAF, ULTRAVOX)
zusammengearbeitet. In dieser Klangumgebung, im deutschen Elektronik-
und Rocksound der Siebzigerjahre, entstanden Riechmanns Kompositionen
für sein Soloalbum "Wunderbar", das zugleich sein Vermächtnis wurde.
Die Scheibe war bereits aufgenommen, als Riechmann während eines abendlichen Spaziergangs in Düsseldorf von zwei alkoholisierten Tätern schwer verletzt wurde und wenige Tage später starb. Nicht einmal mehr die offizielle Veröffentlichung seiner LP miterleben zu können, verleiht diesem frühen Tod eine zusätzliche tragische Dimension, denn Riechmann hatte viel Arbeit investiert, fast alle Instrumente selbst eingespielt und ein offenbar sehr starkes Gefühl der Befriedigung empfunden, dass ihm dieses Werk gelungen war.
Das Album beginnt mit dem Titeltrack, der stark beeinflusst vom damals populären Motorik-Beat mit einem Schlagzeugrhythmus durchzogen ist, der den Song nicht nach dem griffigen und mitsingkompatiblen Schema Strophe-Refrain-Strophe-Refrain strukturiert, sondern eine im Grunde monotone Ausgangsidee mit verschiedenen Melodien kombiniert. Dadurch steht am Ende nicht mehr der Song, sondern der fließende Track - also eine frühe Form späterer elektronischer Ausdrucksformen wie im Ambient oder Techno.
 Für Fans von Jean-Michel Jarre
könnte der Opener "Wunderbar" eine Offenbarung sein und das Stück hätte
auch zweifellos das Zeug zu einem internationalen Hit gehabt. Die
Melodie macht schier süchtig mit ihrer Mischung aus Romantik und
Melancholie, der pulsierende Motorik-Beat gibt ihr ein Gefühl von
leichter, schwebender Unendlichkeit. Andere Momente des 35 Minuten
langen Albums wie die beeindruckenden Tracks "Abendlicht" und
"Silberland" wirken im Vergleich merklich düsterer, sind langsam und
schleppend arrangiert. Wieder andere Passagen orientieren sich an
deutschem Elektronik-Sound à la KLAUS SCHULZE und auch TANGERINE
DREAM-Zitate wird der Kenner der Materie hier mit Sicherheit
heraushören können.
Für Fans von Jean-Michel Jarre
könnte der Opener "Wunderbar" eine Offenbarung sein und das Stück hätte
auch zweifellos das Zeug zu einem internationalen Hit gehabt. Die
Melodie macht schier süchtig mit ihrer Mischung aus Romantik und
Melancholie, der pulsierende Motorik-Beat gibt ihr ein Gefühl von
leichter, schwebender Unendlichkeit. Andere Momente des 35 Minuten
langen Albums wie die beeindruckenden Tracks "Abendlicht" und
"Silberland" wirken im Vergleich merklich düsterer, sind langsam und
schleppend arrangiert. Wieder andere Passagen orientieren sich an
deutschem Elektronik-Sound à la KLAUS SCHULZE und auch TANGERINE
DREAM-Zitate wird der Kenner der Materie hier mit Sicherheit
heraushören können.
Diese Querverweise mögen vielleicht den Eindruck aufkommen lassen, als habe hier jemand sozusagen im Vorbeigehen ein Sammelsurium damals populärer elektronischer Klänge eingetütet und ein Album daraus gemacht. Das wäre allerdings ein recht vorschnelles Urteil, das sicher auch dadurch entstehen mag, dass die genannten Bands und Interpreten sehr viel mehr Musik produzieren konnten und somit ungleich präsenter sind im musikalischen Langzeitgedächtnis. Wolfgang Riechmann dagegen, ein Zeitgenosse und kein bloßer Kopist, hatte nur diese Platte, um ihr seinen Stempel aufzudrücken. Was auf späteren Werken an Ideen und eigener Handschrift noch in Erscheinung hätte treten können, wird für immer ungehört bleiben.
- Stefan - 11/2018

 Da will man mit einem nun wirklich
abgedroschenen Klischee in die nächste Rezension einsteigen und etwas
vom "Sunshine State" faseln, aus dem THE BLACK HEART PROCESSION
stammen, und stellt dann fest, dass mit diesem Begriff natürlich
Florida und nicht etwa Kalifornien gemeint ist (wo die Band tatsächlich
beheimatet ist). Naja, Fehlstart eben. Sonnig ist die Musik von TBHP
aber in keinem Fall, sondern ein mustergültiger Kandidat für unsere
alljährliche Herbstmusik-Strecke. Eingespielt wurde die Scheibe
ebenfalls in dieser Jahreszeit von Ende November bis Anfang Dezember
und das Resultat lässt keine fröhliche Beschwingtheit, keine
sommerliche Unbekümmertheit aufkommen. Auffallend ist, dass sieben von
elf Stücken das Wort "Heart" im Titel tragen, wobei die Platte eher
spärlich instrumentiert beginnt und entsprechend getragen klingt.
Da will man mit einem nun wirklich
abgedroschenen Klischee in die nächste Rezension einsteigen und etwas
vom "Sunshine State" faseln, aus dem THE BLACK HEART PROCESSION
stammen, und stellt dann fest, dass mit diesem Begriff natürlich
Florida und nicht etwa Kalifornien gemeint ist (wo die Band tatsächlich
beheimatet ist). Naja, Fehlstart eben. Sonnig ist die Musik von TBHP
aber in keinem Fall, sondern ein mustergültiger Kandidat für unsere
alljährliche Herbstmusik-Strecke. Eingespielt wurde die Scheibe
ebenfalls in dieser Jahreszeit von Ende November bis Anfang Dezember
und das Resultat lässt keine fröhliche Beschwingtheit, keine
sommerliche Unbekümmertheit aufkommen. Auffallend ist, dass sieben von
elf Stücken das Wort "Heart" im Titel tragen, wobei die Platte eher
spärlich instrumentiert beginnt und entsprechend getragen klingt.
Mit dem dritten Song "Release my Heart" erweitert sich dann das musikalische Spektrum, die traurige Stimmung jedoch bleibt bestehen. Am stärksten ist die Band dann, wenn sie sich auf das Zusammenspiel von Piano, Drums und Gitarre konzentriert. Allerdings spielen auch die musikalisch anders strukturierten Stücke eine wichtige Rolle, sorgen sie doch für eine gewisse Abwechslung, ohne allerdings zu sehr vom roten Faden abzuweichen. Dadurch behält das Debutalbum, das auch mit den Titeln "One" bzw. "1" bezeichnet wird, seine innere Geschlossenheit. Sehr düster wird's mit dem knapp einminütigen Intermezzo "The Winter my Heart froze" und dem sich direkt anschließenden "Stitched to my Heart", die eindrucksvoll dargeboten sind, aber Menschen mit depressivem Gemüt keineswegs als musikalischer Stimmungsaufheller empfohlen werden können.
 Wenn sich so etwas wie ein Hit auf
dem Album befinden sollte, dürfte das "Square Heart" sein, bei dem sich
die Stärken von TBHP eindrucksvoll bündeln. Der Gesang ist
melancholisch und leicht leidend, ohne aber in sülziges Gejammer
abzugleiten (was bei dieser Art von Musik ja durchaus passieren kann).
Den regulären Abschluss bildet das mit beträchtlichem Abstand längste
Stück "A Heart the Size of a Horse", langsam und fast feierlich, ohne
dass kompositorisch hier noch sehr viel Aufwand betrieben würde. Die
limitierte Neuauflage, von der Band selbst anlässlich der letztjährigen
Europatour im Eigenverlag veröffentlicht, enthält noch zwei
Bonustracks, allerdings soll die Stückzahl dieser Pressung bei gerade
mal 300 Exemplaren liegen (bei Interesse discogs.com ansteuern, dort
findet man aktuell noch einige Angebote zu ziemlich moderaten Preisen).
Wenn sich so etwas wie ein Hit auf
dem Album befinden sollte, dürfte das "Square Heart" sein, bei dem sich
die Stärken von TBHP eindrucksvoll bündeln. Der Gesang ist
melancholisch und leicht leidend, ohne aber in sülziges Gejammer
abzugleiten (was bei dieser Art von Musik ja durchaus passieren kann).
Den regulären Abschluss bildet das mit beträchtlichem Abstand längste
Stück "A Heart the Size of a Horse", langsam und fast feierlich, ohne
dass kompositorisch hier noch sehr viel Aufwand betrieben würde. Die
limitierte Neuauflage, von der Band selbst anlässlich der letztjährigen
Europatour im Eigenverlag veröffentlicht, enthält noch zwei
Bonustracks, allerdings soll die Stückzahl dieser Pressung bei gerade
mal 300 Exemplaren liegen (bei Interesse discogs.com ansteuern, dort
findet man aktuell noch einige Angebote zu ziemlich moderaten Preisen).
In seiner jahreszeitbegleitenden Stimmung könnte man mit dieser Scheibe auch gleich die Herbstmusik dieses Jahres beenden, aber es stehen uns ja noch einige Wochen bevor, sei es mit kühlem, nasskaltem Wetter oder mit sonnigen Altweibersommer-Überbleibseln. Dabei werden auch wieder Klänge zu vernehmen sein, die etwas weniger deprimierend anmuten und nicht nur der Soundtrack für graue, nebelverhangene Tage sind.
- Stefan - 11/2018
Falls sich jemand durch den letzten Abschnitt diskriminiert fühlt, möge er/sie dazu Wikipedia konsultieren: "Das Landgericht Darmstadt hat im Jahr 1989 festgestellt, dass die Verwendung des Ausdrucks Altweibersommer durch die Medien keinen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von älteren Damen darstellt." (LG Darmstadt, Az. 3 O 535/88)
 Was macht man mit einer
Band, die sich THE DECEMBERISTS nennt? Genau, in die
November-Herbstmusik packen und sich damit schon wieder um den Preis
für die unpassendste Über- bzw. Einleitung des Jahres bewerben. Die
Formation aus Portland in Oregon tat sich für dieses Album mit der
englischen Sängerin Olivia Chaney zusammen, um gemeinsam liebgewonnenen
Folk-Standards und alten Traditionals zu huldigen. Namentlich firmiert
dieser musikalische Zusammenschluss unter dem Banner OFFA REX, benannt
nach jenem Angelsachsen, der im 8. Jahrhundert im Grunde als erster
König von England gelten konnte, zumindest mit Blick auf das von ihm
zeitweilig beherrschte Territorium. Offa Rex war zudem auch ein
Schriftzug, welcher damals geprägte Münzen zierte, die bis heute
erhalten geblieben sind.
Was macht man mit einer
Band, die sich THE DECEMBERISTS nennt? Genau, in die
November-Herbstmusik packen und sich damit schon wieder um den Preis
für die unpassendste Über- bzw. Einleitung des Jahres bewerben. Die
Formation aus Portland in Oregon tat sich für dieses Album mit der
englischen Sängerin Olivia Chaney zusammen, um gemeinsam liebgewonnenen
Folk-Standards und alten Traditionals zu huldigen. Namentlich firmiert
dieser musikalische Zusammenschluss unter dem Banner OFFA REX, benannt
nach jenem Angelsachsen, der im 8. Jahrhundert im Grunde als erster
König von England gelten konnte, zumindest mit Blick auf das von ihm
zeitweilig beherrschte Territorium. Offa Rex war zudem auch ein
Schriftzug, welcher damals geprägte Münzen zierte, die bis heute
erhalten geblieben sind.
Die dominierende Klangfarbe auf "The Queen of Hearts" ist die melancholische Ballade, aber auch Ausflüge in Midtempo-Folknummern kommen zu ihrem Recht. Die Gesangparts teilen sich Olivia Chaney (mehrheitlich) und Colin Meloy, was ebenfalls zu einer angenehmen Vielfalt beiträgt. Möglicherweise war es taktisch etwas unklug, zu Beginn gleich mit zwei großen Highlights, dem Titelsong und dem folkigen "Blackleg Miner" aufzuwarten, denn damit ist die Messlatte schon relativ hoch gelegt für einige Passagen des nachfolgenden Materials, das den Eingangsstandard im direkten Vergleich nicht immer halten kann. Andererseits zeugt es vom Selbstbewusstsein der Band, die auch Anhängern von Gruppen wie den WALKABOUTS ans Herz gelegt werden darf, da es bei den ruhiger gehaltenen Stücken einige musikalische Schnittmengen gibt.
 Ein kleiner Ausreißer ist der
vorletzte Track "Sheepcrook and black Dog", bei dem überraschenderweise
sogar doomige Hardrock-Riffs auftauchen, was als Stilmittel glänzend
funktioniert und sich ganz organisch ins Klangspektrum einfügt, als
habe es schon immer dorthin gehört. Manche Songs sind für die Freunde
der Stromgitarre vielleicht einen Tick zu ruhig, passend aber sehr
schön in die langsam doch ziemlich kühl werdende Jahreszeit. Für den
besinnlichen Musikabend zu Hause gibt's die OFFA REX-Platte für den
traditionsbewussten Hörer auch als Vinyl, welches beim großen A
tatsächlich zum vernünftigen Preis (immerhin unter 20 Euro) angeboten
wird und das inklusive einer Gratis-mp3-Version des Albums. Kein
Standard in Zeiten massiv teurer Vinylscheiben, aber das ist eine
andere Geschichte...
Ein kleiner Ausreißer ist der
vorletzte Track "Sheepcrook and black Dog", bei dem überraschenderweise
sogar doomige Hardrock-Riffs auftauchen, was als Stilmittel glänzend
funktioniert und sich ganz organisch ins Klangspektrum einfügt, als
habe es schon immer dorthin gehört. Manche Songs sind für die Freunde
der Stromgitarre vielleicht einen Tick zu ruhig, passend aber sehr
schön in die langsam doch ziemlich kühl werdende Jahreszeit. Für den
besinnlichen Musikabend zu Hause gibt's die OFFA REX-Platte für den
traditionsbewussten Hörer auch als Vinyl, welches beim großen A
tatsächlich zum vernünftigen Preis (immerhin unter 20 Euro) angeboten
wird und das inklusive einer Gratis-mp3-Version des Albums. Kein
Standard in Zeiten massiv teurer Vinylscheiben, aber das ist eine
andere Geschichte...
- Stefan -11/2018

 Jetzt gehen wir mal
ganz weit zurück in der Herbstmusik, denn viele der
Redaktionsmitglieder waren noch gar nicht geboren, als dieses Album
erschien, oder zumindest nicht in der Lage, den Tonarm des
Dual-Plattenspielers ohne Beschädigung der Schallplatte zu bedienen.
Eigentlich eher ein Album unserer älteren Brüder, die vielleicht immer
noch diskutieren, welches das beste Werk von Jethro Tull ist,
"Aqualung" dürfte aber wohl das bekannteste sein.
Jetzt gehen wir mal
ganz weit zurück in der Herbstmusik, denn viele der
Redaktionsmitglieder waren noch gar nicht geboren, als dieses Album
erschien, oder zumindest nicht in der Lage, den Tonarm des
Dual-Plattenspielers ohne Beschädigung der Schallplatte zu bedienen.
Eigentlich eher ein Album unserer älteren Brüder, die vielleicht immer
noch diskutieren, welches das beste Werk von Jethro Tull ist,
"Aqualung" dürfte aber wohl das bekannteste sein.
Nach vielen Jahren habe ich "Aqualung" in der gelungenen remasterten
Fassung von 1996 wieder mal in den Player gelegt und war begeistert von
der Bandbreite an instrumentalen und kompositorischen Einfällen. Jethro
Tull knüpfen hier aus akustischen folkigen Stücken und breit angelegten
Progressiv-Rock-Epen einen Teppich, dessen Grundfarben ich
synästhetisch als herbstlich Gelb, Braun und Grün sehen würde. Ian
Anderson hat den wandernden Barden ebenso wie den zynischen Spötter
drauf - sehr schön zu hören und zu sehen in der unten stehenden
Live-Version des Titeltracks. Zudem brachte er die Querflöte in die
Rockmusik, was unter anderem Buddy Lackey von Psychotic Waltz
beeinflusste.
"Lokomotive Breath" ist das bekannteste Stück des Albums, und mir fiel
beim erneuten Hören auf, wie die Erinnerung das einminütige Piano-Intro
unterschlagen hatte, zu markant ist das Gitarrenriff (welches im
Gitarrenunterricht gern zu Einführung des Schlagens auf gedämpften
Seiten herangezogen wird). Unten in einer Live-Version aus den 70er
Jahren, zeitbedingt mit onanistischem Gitarren-Solo.
Deutlich komplexer ist der Opener und Titelsong über den schmierigen
todkranken Bettler "Aqualung". Musikalisch und textlich drückt Anderson
hier sowohl Abscheu gegenüber dieser Kreatur, die "kleine Mädchen mit
schlechten Absichten beäugt", während Rotz aus ihrer Nase läuft als
auch Mitleid und Verständnis für den gequälten Mit-Menschen, den
einsamen alten Mann, dessen Bein schmerzt und der sich in einer
öffentlichen Toilette die Füße aufwärmt. Im nächsten Song über die sich
prostituierende Schülerin "Cross-Eyed Mary" hat er nochmal ein kurzes
Gastspiel.
Sozialkritik und die Auseinandersetzung Ian Andersons mit Gott und
menschgemachter Religion sind die Themen auf "Aqualung".

Es ist vielleicht gut, dass ich das Album altersbedingt
schon immer vom zeitlichen Kontext losgelöst hören konnte, mich der
Musik ganz naiv widmen kann ohne zwangsläufig Vergleiche zu anderen
Bands oder Alben dieser Jahre ziehen zu müssen. Ich mag diesen
speziellen Gitarrensound der Rock-Musik der 70er Jahre, warm und
analog, auch remastered immer mit leisem Grundrauschen und heute so
wenig reproduzierbar wie der Fotolook, den Instagramer digital zu
imitieren versuchen. Die Live-Auftritte aus jener Zeit wirken schon
sehr waldschratig, aber sympathisch, Hobbits auf Speed…
Ja, und die Bärte… sicher sollten sie schon damals jungen Männern (Ian
Anderson war beim Erscheinen des Albums 24) den Nimbus von Reife und
Erfahrung verleihen, doch verband man damit eher Unangepasstheit und
Landkommune statt Altbauwohnung mit Möbeln aus hippen Euro-Paletten,
obwohl man sich richtige leisten könnte.
Jethro Tull durchliefen nach "Aqualung" verschiedene stilistische
Phasen und erhielten 1988, dem Jahr in dem "… And Justice For All"
veröffentlicht wurde, gar irritierenderweise den Grammy für die beste
"Hard Rock/Metal Performance". Das letzte Studio-Album erschien 2003,
doch Ian Anderson tourt immer noch durch die Lande, ob seiner
stimmlichen Leistungen nicht immer zu Freude der alten Fans.
- Martin - 12/2018
 Ein
Künstler, der trotz seines umfangreichen Schaffens bis dato immer etwas
unter dem Radar unterwegs war, ist der Engländer Paul Roland. Seit Ende
der Siebziger nimmt er (mit einer längeren Unterbrechung) regelmäßig
Platten auf, wenngleich der Buchautor Roland größere Erfolge zu
verbuchen hat. So vielseitig die Themen seiner Songs sind, klingt auch
seine Musik und dennoch ist die persönliche, unverwechselbare
Handschrift stets erkennbar. Die musikalische Bandbreite reicht von
folkigen Balladen bis zu rockigeren Stücken, bei denen das Tempo auch
mal etwas angezogen wird. Die Geschichten seiner Songs drehen sich um
die Themen des klassischen Schauerromans und Artverwandtes. Der Freund
spannender Storys von und über Jack the Ripper, H.P. Lovecraft, Edgar
Allan Poe, Sherlock Holmes, Fu Man Chu und vielem mehr wird hier ebenso
fündig wie der Liebhaber stimmungsvoll-eigenwilliger Musik für ruhige
Herbstabende. Bei einer solchen Fülle an unterschiedlichen Arbeiten
liegt es also nahe, mit einer Compilation ins Thema einzusteigen.
Ein
Künstler, der trotz seines umfangreichen Schaffens bis dato immer etwas
unter dem Radar unterwegs war, ist der Engländer Paul Roland. Seit Ende
der Siebziger nimmt er (mit einer längeren Unterbrechung) regelmäßig
Platten auf, wenngleich der Buchautor Roland größere Erfolge zu
verbuchen hat. So vielseitig die Themen seiner Songs sind, klingt auch
seine Musik und dennoch ist die persönliche, unverwechselbare
Handschrift stets erkennbar. Die musikalische Bandbreite reicht von
folkigen Balladen bis zu rockigeren Stücken, bei denen das Tempo auch
mal etwas angezogen wird. Die Geschichten seiner Songs drehen sich um
die Themen des klassischen Schauerromans und Artverwandtes. Der Freund
spannender Storys von und über Jack the Ripper, H.P. Lovecraft, Edgar
Allan Poe, Sherlock Holmes, Fu Man Chu und vielem mehr wird hier ebenso
fündig wie der Liebhaber stimmungsvoll-eigenwilliger Musik für ruhige
Herbstabende. Bei einer solchen Fülle an unterschiedlichen Arbeiten
liegt es also nahe, mit einer Compilation ins Thema einzusteigen.
Das Doppelalbum "Gaslight Tales" versammelt eine stilistisch breit gefächerte Auswahl von Songs, die aus der "ersten Karriere" Rolands stammen, die er dann zugunsten seiner schriftstellerischen Tätigkeit auf Eis gelegt hatte. Die 38 Stücke sind keiner für alle geltenden Stilrichtung zuzuordnen, was auch den Charakter Paul Rolands als Musiker und Komponist widerspiegelt. Er hat ganz offensichtlich immer das gespielt, was ihm persönlich ein Anliegen war, wodurch es nie zu einem größeren Hit reichte. Eine großartige Ballade wie "The Great Edwardian Air-Raid" steht hier vollkommen gleichberechtigt neben einem eingängigen Gothic-Rocker wie "Werewolves of London", ohne dass sich eine dieser beiden Richtungen als dominant oder besonders typisch gegenüber anderen musikalischen Exkursen herausgestellt hätte. Selbst wenn die ruhigeren Töne insgesamt schon in der Mehrheit sind, gewährt Rolands Musik auch anderen Stimmungen ihren eigenen Raum.
Zusammenstellungen wie "Gaslight Tales" bieten dem Neueinsteiger die willkommene Möglichkeit, sich im weitläufigen Schaffen des Engländers zu orientieren. Seiner markanten Stimme ist es zu verdanken, dass sowohl Balladen wie auch Songs mit einem flotteren Stromgitarrenanteil sehr gut funktionieren. Was auch an den Texten liegt, in denen Paul Roland den Hörer wie ein Geschichtenerzähler in Welten entführt, die sich ganz bewusst von zeitgenössischen oder gar politischen Inhalten abgrenzen, ohne dabei den Künstler weltfremd werden zu lassen. Roland hat sich vielmehr einen eigenen musikalischen Kosmos geschaffen, in dem einem eine Vielzahl bekannter Figuren aus Literatur und Film begegnet. Und so fühlt man sich denn auch gleich heimisch in dieser ausgesprochen kreativen und weitschichtigen Musik, als hätte man sie schon immer gekannt.

So vielfältig wie die Eindrücke sind, die "Gaslight Tales" bietet, kann diese Compilation mehr sein als nur eine Art "Best of"-Auswertung, sondern auch ein erster Schritt zu weiteren Entdeckungsreisen. Die nachfolgenden Studioalben wie "Pavane" (2004) oder "Bates Motel" (2013) zeigen, dass Rolands mehrere Jahre andauernde Aufnahmepause nichts an Qualität und künstlerischer Ausdruckskraft hatte verlorengehen lassen. "Pavane" ist im Vergleich deutlich ruhiger und stimmungsvoller, während "Bates Motel" (ursprünglich bereits in den Achtzigern als Zusammenarbeit mit Musikern von Velvet Underground geplant) gelegentlich auch schon mal einen Gang raufschaltet. Diese musikalische Wandlungsfähigkeit ist der beste Beweis dafür, dass sich Beständigkeit eben nicht darin äußern muss, im Grunde stets das Gleiche zu produzieren.
Paul Roland ist ein ungemein charakteristischer, aber deshalb trotzdem nicht in allem berechenbarer musikalischer Dichter, den ein zu großer kommerzieller Erfolg vielleicht nur dem ungesunden Druck seitens der Musikindustrie ausgesetzt hätte, weil eine Plattenfirma ja recht gern auf das Verfolgen einer lukrativen Formel drängt und das Unerwartete weniger schätzt. Und so ist Roland als "Edgar Allan Poe der Rockmusik" (Selbsteinschätzung) ein bei den Fans hochgeachteter Geheimtipp geblieben, dem es auch ohne den Einsatz der großen Werbemaschinerie gelang, sein internationales und vor allem treues Publikum zu finden.
-Stefan - 12/2018

 Draußen liegt der erste
Schnee und die nächtlichen Minusgrade haben sich auf dem Thermometer
etabliert. Klarer Fall: Jetzt muss noch mal die Stromgitarre ran, der
musikalische Bollerofen kommt zum Einsatz. WITH THE DEAD waren zu
Beginn (also beim vorliegenden Erstlingswerk) ein Zusammenschluss von
ehemaligen ELECTRIC WIZARD-Musikern mit Lee Dorrian, Labelchef von Rise
Above Records und noch früher Gesangsakrobat bei CATHEDRAL und NAPALM
DEATH. Entsprechend sind fein ausgeklügelte Songs mit Prog-Anleihen und
anspruchsvollen Gesangslinien hier nicht zu erwarten. WITH THE DEAD
sind die linientreue Fortführung von EW-Werken wie "Dopethrone" und
zumindest musikalisch weniger dem Siebziger-Doom à la SABBATH oder dem
Doom Metal im Stil von CANDLEMASS verpflichtet. Tonnenschwere Riffs
werden hier zelebriert, was zugegeben zu Lasten der Abwechslung geht.
Dafür wummert einem die Doomwalze mit angenehm wuchtigem Gitarrensound
durchs Gebein und weckt so die Lebensgeister.
Draußen liegt der erste
Schnee und die nächtlichen Minusgrade haben sich auf dem Thermometer
etabliert. Klarer Fall: Jetzt muss noch mal die Stromgitarre ran, der
musikalische Bollerofen kommt zum Einsatz. WITH THE DEAD waren zu
Beginn (also beim vorliegenden Erstlingswerk) ein Zusammenschluss von
ehemaligen ELECTRIC WIZARD-Musikern mit Lee Dorrian, Labelchef von Rise
Above Records und noch früher Gesangsakrobat bei CATHEDRAL und NAPALM
DEATH. Entsprechend sind fein ausgeklügelte Songs mit Prog-Anleihen und
anspruchsvollen Gesangslinien hier nicht zu erwarten. WITH THE DEAD
sind die linientreue Fortführung von EW-Werken wie "Dopethrone" und
zumindest musikalisch weniger dem Siebziger-Doom à la SABBATH oder dem
Doom Metal im Stil von CANDLEMASS verpflichtet. Tonnenschwere Riffs
werden hier zelebriert, was zugegeben zu Lasten der Abwechslung geht.
Dafür wummert einem die Doomwalze mit angenehm wuchtigem Gitarrensound
durchs Gebein und weckt so die Lebensgeister.
Die drei Herren auf dem Cover (stilecht im Paul-Chain-Gedächtnisoutfit und in Weihrauch eingenebelt) wirken ein wenig untot, was natürlich prima zum Bilderkanon des Genres passt und stilistisch an frühere Bands der Beteiligten anknüpft. Sechs Stücke mit 42 Minuten Laufzeit ergibt im Schnitt sieben Minuten pro Track, was dem Kenner nahelegt: WITH THE DEAD sind keine Hektiker. Die Kritiken unter Doomfans fielen durchwachsen aus, was man nachvollziehen kann. Das WTD-Trio war nicht an aufwendig ausgearbeiteten Songs interessiert, es setzte eindeutig auf die Wirkung von Wuchtigkeit und Wiederholung. So etwas kann leicht Monotonie auslösen und damit Langeweile beim Hörer. Auf der anderen Seite sind die Beteiligten natürlich alte Hasen im Geschäft und wissen, wie man Riffteppiche wirksam einsetzt. Auf dieser Ebene funktioniert das Album durchaus effektiv, auch wenn der Doom-Gruft damit keine musikalische Weltneuheit entstiegen ist.
 Das offenbart sich,
wenn gelungenen Stücken wie "The Cross" oder "Living with the Dead" der
ereignisarme Track "Nephthys" gegenübersteht, der schon noch einiges an
kompositorischem Feinschliff hätte vertragen können. Sänger Lee
Dorrian, bei dem seit alten CATHEDRAL-Tagen eigentlich klar ist, dass
er technisch zu limitiert singt, um neben einer markanten Stimme auch
eine technisch ausgefeiltere Performance bieten zu können, kann sich
recht gut in Szene setzen, wenn er sich so präsentiert wie in "I am
your Virus". Es wird zwar in diesem Leben kein Heldentenor mehr aus ihm
werden, aber im Rahmen des Notwendigen passt hier die Grabplatte schon
auf den Sarkophag. Der Rausschmeißer "Scream from my own Grave" walzt
sich in schwerer Slow Motion dem Ende entgegen, fügt dem Ganzen aber
(wie zu erwarten) keine neue Dimension mehr hinzu. Fazit: Nicht alles
genügt höchsten Qualitätsansprüchen, aber für hartgesottene
Doom-Freunde gibt es vieles von dem, was die Fangemeinde wünscht. Nur
der bisweilen gewählte Terminus "Supergroup" wirkt, bei allem Respekt
vor den Mitwirkenden, schon sehr übertrieben.
Das offenbart sich,
wenn gelungenen Stücken wie "The Cross" oder "Living with the Dead" der
ereignisarme Track "Nephthys" gegenübersteht, der schon noch einiges an
kompositorischem Feinschliff hätte vertragen können. Sänger Lee
Dorrian, bei dem seit alten CATHEDRAL-Tagen eigentlich klar ist, dass
er technisch zu limitiert singt, um neben einer markanten Stimme auch
eine technisch ausgefeiltere Performance bieten zu können, kann sich
recht gut in Szene setzen, wenn er sich so präsentiert wie in "I am
your Virus". Es wird zwar in diesem Leben kein Heldentenor mehr aus ihm
werden, aber im Rahmen des Notwendigen passt hier die Grabplatte schon
auf den Sarkophag. Der Rausschmeißer "Scream from my own Grave" walzt
sich in schwerer Slow Motion dem Ende entgegen, fügt dem Ganzen aber
(wie zu erwarten) keine neue Dimension mehr hinzu. Fazit: Nicht alles
genügt höchsten Qualitätsansprüchen, aber für hartgesottene
Doom-Freunde gibt es vieles von dem, was die Fangemeinde wünscht. Nur
der bisweilen gewählte Terminus "Supergroup" wirkt, bei allem Respekt
vor den Mitwirkenden, schon sehr übertrieben.
- Stefan - 12/2018