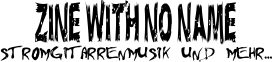

„Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten“
(Rainer Maria Rilke)
 Seit etwas mehr als 20
Jahren sind die beiden Sanniti-Brüder Alessio (Gitarre) und Vincenzo
(Bass) unter dem Namen MISANTROPUS in wechselnder Besetzung unterwegs.
Auffallend ist auf den ersten Blick zunächst die irritierende
Gestaltung einiger Cover, die der kunstgeschichtliche Laie in mir der
naiven Malerei zuordnen würde. Speziell das Motiv der
2013er-Veröffentlichung erinnert an Schulheftkritzeleien, die zum
Zeitvertreib entstanden sind und normalerweise eher selten den Weg auf
offizielle Tonträgerhüllen finden.
Seit etwas mehr als 20
Jahren sind die beiden Sanniti-Brüder Alessio (Gitarre) und Vincenzo
(Bass) unter dem Namen MISANTROPUS in wechselnder Besetzung unterwegs.
Auffallend ist auf den ersten Blick zunächst die irritierende
Gestaltung einiger Cover, die der kunstgeschichtliche Laie in mir der
naiven Malerei zuordnen würde. Speziell das Motiv der
2013er-Veröffentlichung erinnert an Schulheftkritzeleien, die zum
Zeitvertreib entstanden sind und normalerweise eher selten den Weg auf
offizielle Tonträgerhüllen finden.
Spirituell haben sich die beiden Italiener auf „The Gnomes“, unterstützt von einem Drummer, von der Natur und ihren Elementen leiten lassen. Musikalisch ist die Struktur der vier Tracks bewusst primitiv gehalten und setzt ganz auf das Prinzip permanenter Wiederholung. Intro und Outro nehmen zusammen etwas mehr als acht Minuten ein und bestehen aus einer düster tönenden Soundkulisse. Die eigentlichen Stücke legen eine Distanz von ca. einer halben Stunde zurück, wobei es hier schon kniffliger wird: Gäbe es die Pausen zwischen den rein instrumentalen Tracks nicht, wären sie nicht allzu leicht voneinander zu unterscheiden. Mit großer Beharrlichkeit wird ein Midtempo-Gitarrenriff minutenlang wiederholt, gelegentlich von einer langsamen Passage unterbrochen, danach wieder aufgenommen und fortgeführt. Für hektische Gemüter, die nicht stillsitzen können, mag dies mangels Abwechslung bereits eine Geduldsprobe darstellen, aber nach den ersten zehn Minuten haben MISANTROPUS sich gerade mal warmgespielt.
 So wie auch die Natur
aus einem ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen besteht, entfaltet
auf diesem Album ein vergleichbares Prinzip seine Wirkung. Wozu ein
Riff nur für einen Track verwenden, warum nicht ganz im Sinne des
Umweltschutzes den Mehrweg-Gedanken verinnerlichen? Und so wird das
bereits bekannte Riff zum flauschigen, bequemen Doom-Teppich für die
gesamte Platte, wobei die Herren die Monotonie hier noch nicht bis zum
Exzess treiben, denn nach knapp einer Viertelstunde setzt ein zweiter
Gitarrenpart ein, der nach kurzer Zeit allerdings wieder eingefangen
wird. Wer für die zweite Hälfte des Albums auf mehr Abwechslung gehofft
hatte, dürfte zusehends im Treibsand eines schier endlos um sich selbst
kreisenden Riffs untergehen…
So wie auch die Natur
aus einem ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen besteht, entfaltet
auf diesem Album ein vergleichbares Prinzip seine Wirkung. Wozu ein
Riff nur für einen Track verwenden, warum nicht ganz im Sinne des
Umweltschutzes den Mehrweg-Gedanken verinnerlichen? Und so wird das
bereits bekannte Riff zum flauschigen, bequemen Doom-Teppich für die
gesamte Platte, wobei die Herren die Monotonie hier noch nicht bis zum
Exzess treiben, denn nach knapp einer Viertelstunde setzt ein zweiter
Gitarrenpart ein, der nach kurzer Zeit allerdings wieder eingefangen
wird. Wer für die zweite Hälfte des Albums auf mehr Abwechslung gehofft
hatte, dürfte zusehends im Treibsand eines schier endlos um sich selbst
kreisenden Riffs untergehen…
Spätestens im vierten Track entwickelt sich das Gefühl, als sei man zusammen mit der Band wie bei einer LP an einer defekten Stelle hängengeblieben und müsste bis zum Ende aller Zeiten stets das gleiche Riff spielen bzw. hören. Doch ein Ausweg besteht und sei es nur das Überblenden in ein ausgedehntes Outro mit Drone-Elementen, das geschlagene sechs Minuten lang den Hörer in einen anderen Soundkosmos entlässt. Nach erstmaligem Hören mag die Scheibe vielleicht noch tödlich langweilig anmuten, aber das täuscht: Die verschrobene Geschlossenheit hat ihren Reiz, von Anbiederung und Gefallsucht sind MISANTROPUS weit entfernt.
„The Gnomes“ ist auf CD und in zwei limitierten Vinyl-Ausgaben erschienen, in digitaler Form mittels Streaming und Download wird man bei Bandcamp fündig. Bei Interesse einfach HIER entlang…
- Stefan - 10/2019
 Als die schwedische Band ANEKDOTEN im Jahr 2003 ihr damals
fünftes Album veröffentlichte, hatte sie seit dem Erscheinen ihres
Debüts bereits eine Strecke von zehn Jahren zurückgelegt. Wenn ich mich
recht entsinne, war ich mit der Band erstmals über ein Interview im
„Eternal Flame“-Fanzine in Berührung gekommen, hatte sie aber nicht
eingehender wahrgenommen. Auf „Gravity“ hatte sich ein bereits einige
Zeit zuvor vollzogener Stilwandel etabliert, weg vom etwas schrofferen
Sound mit King-Crimson-Einflüssen hin zu einem weicheren, fließenden
Klang, was die Fans der frühen Jahre teils mit Befremdung wahrnahmen,
wenn man zeitgenössische Reviews zu Rate zieht. Formulierungen wie
„Guter Alternative Rock“ waren vor diesem Hintergrund eher als Vorwurf
gemeint, so nach dem Motto „Jetzt sind sie banal geworden“. Auch das
Verschwinden von dominanteren Prog-Elementen zugunsten von
Psychedelic-Sounds passte da ins Bild. Wenn dann noch Vokabeln wie
„songdienlich“ auftauchen, könnte man den Eindruck bekommen, die Band
wäre hier in der Belanglosigkeit angekommen.
Als die schwedische Band ANEKDOTEN im Jahr 2003 ihr damals
fünftes Album veröffentlichte, hatte sie seit dem Erscheinen ihres
Debüts bereits eine Strecke von zehn Jahren zurückgelegt. Wenn ich mich
recht entsinne, war ich mit der Band erstmals über ein Interview im
„Eternal Flame“-Fanzine in Berührung gekommen, hatte sie aber nicht
eingehender wahrgenommen. Auf „Gravity“ hatte sich ein bereits einige
Zeit zuvor vollzogener Stilwandel etabliert, weg vom etwas schrofferen
Sound mit King-Crimson-Einflüssen hin zu einem weicheren, fließenden
Klang, was die Fans der frühen Jahre teils mit Befremdung wahrnahmen,
wenn man zeitgenössische Reviews zu Rate zieht. Formulierungen wie
„Guter Alternative Rock“ waren vor diesem Hintergrund eher als Vorwurf
gemeint, so nach dem Motto „Jetzt sind sie banal geworden“. Auch das
Verschwinden von dominanteren Prog-Elementen zugunsten von
Psychedelic-Sounds passte da ins Bild. Wenn dann noch Vokabeln wie
„songdienlich“ auftauchen, könnte man den Eindruck bekommen, die Band
wäre hier in der Belanglosigkeit angekommen.
 Über 15 Jahre nach seiner Entstehung kann „Gravity“ diesen
seinerzeit unterstellten Malus aber als unzutreffend zurückweisen.
Sicher, besonders sperrig oder schräg klingen ANEKDOTEN hier nicht,
eher sanft und in sich ruhend. Wer es zumindest phasenweise etwas
ungezügelter und losgelöster mag, wird auf diesem Longplayer kaum
fündig werden, für die herbstliche Jahreszeit ist die Scheibe aber ein
angenehmer Soundtrack. Als zu glatt und kommerziell würde ich das
Material jedoch nicht unbedingt bezeichnen, denn die einzelnen Tracks
sind trotz ihrer ruhigeren Grundstruktur nicht auf besondere
Eingängigkeit mit Blick auf das wirklich große Publikum hin komponiert
– dafür fehlen die großen einprägsamen Refrains oder ähnliche Elemente.
Über 15 Jahre nach seiner Entstehung kann „Gravity“ diesen
seinerzeit unterstellten Malus aber als unzutreffend zurückweisen.
Sicher, besonders sperrig oder schräg klingen ANEKDOTEN hier nicht,
eher sanft und in sich ruhend. Wer es zumindest phasenweise etwas
ungezügelter und losgelöster mag, wird auf diesem Longplayer kaum
fündig werden, für die herbstliche Jahreszeit ist die Scheibe aber ein
angenehmer Soundtrack. Als zu glatt und kommerziell würde ich das
Material jedoch nicht unbedingt bezeichnen, denn die einzelnen Tracks
sind trotz ihrer ruhigeren Grundstruktur nicht auf besondere
Eingängigkeit mit Blick auf das wirklich große Publikum hin komponiert
– dafür fehlen die großen einprägsamen Refrains oder ähnliche Elemente.
Etwas gewöhnungsbedürftig ist mitunter der Gesang, der an einigen
Stellen zu unbeteiligt wirkt und sich in seiner Phrasierung an die
Struktur der Instrumentierung anlehnt, wodurch er etwas an
Ausdruckskraft verliert bzw. in den Hintergrund tritt. An anderer
Stelle, etwa beim herausragenden Titeltrack (unten in einer knapp
15minütigen Live-Version verlinkt), ist die Band jedoch ganz bei sich.
Einen schönen Ausklang bilden die letzten beiden Stücke: zum einen das
sehr ruhige und melodiöse „The Games we play“, gefolgt vom rockigeren
Instrumental „Seljak“, das (in Maßen) das Tempo anzieht und dabei
ziemlich aprupt endet. Auch wenn für Anhänger der ersten Stunde
„Gravity“ insgesamt betrachtet wohl kein Prog-Hochamt mehr darstellen
wird, lohnt sich ein Antesten durchaus. Der erste Eindruck mag
vielleicht noch eher spröde und unspektakulär ausfallen, aber in der
dazu passenden Herbststimmung gehört ist das Album zu empfehlen.
- Stefan - 10/2019

 Deutschen Indie-Punk in der Herbstmusik hatten wir schon
einmal im Jahr
2014 mit EA80, nun sind die Kollegen von LOVE A mit ihrem vierten
Album an der Reihe. Wobei Punk auch hier den Kern der Sache nicht
trifft: LOVE A nehmen Elemente daraus, entwickeln sie mit Einflüssen
von Joy Division bis Interpol weiter. Darüber thront ein Sänger, der
nicht bei allen Hörern auf ungeteilten Beifall stößt („Vollkatastrophe“
meint ein Leserkommentar auf laut.de). Aber wie das häufig so ist mit
meinungsstarkem Getöse im Netz: Die Wirklichkeit sieht anders aus und
ist viel differenzierter.
Deutschen Indie-Punk in der Herbstmusik hatten wir schon
einmal im Jahr
2014 mit EA80, nun sind die Kollegen von LOVE A mit ihrem vierten
Album an der Reihe. Wobei Punk auch hier den Kern der Sache nicht
trifft: LOVE A nehmen Elemente daraus, entwickeln sie mit Einflüssen
von Joy Division bis Interpol weiter. Darüber thront ein Sänger, der
nicht bei allen Hörern auf ungeteilten Beifall stößt („Vollkatastrophe“
meint ein Leserkommentar auf laut.de). Aber wie das häufig so ist mit
meinungsstarkem Getöse im Netz: Die Wirklichkeit sieht anders aus und
ist viel differenzierter.
Wie bei Post-Punk-Bands der späten Siebziger, frühen Achtziger spielt auch hier der treibende Bass als Rückgrat eine grundlegende Rolle, vorangetrieben von präzisen Drums und akzentuierten Gitarren. Das ist nicht notwendigerweise besonders originell und neu erfunden hat sich die Band damit auch nicht, aber es ist zweifellos gekonnt. Inhaltlich dreht sich das Album, seinem Titel folgend, um die enervierende, sich wiederholende Eintönigkeit des Alltags und des menschlichen Daseins. Auch über wohlbekannte deutsche Befindlichkeiten stolpert man in den Texten, trifft auf aggressive Unzufriedenheit und Dauergenörgel als Begleitsoundtrack, der gerade wieder sehr aktuell geworden ist.

Dazu passt es dann auch, wenn Teile der Texte parolenartig hinausgerufen werden wie in „Unkraut“, wenn „alle Nerven blank“ liegen, wenn der „Deutsche wie immer unzufrieden“ ist („Löwenzahn“) und Schlagworte aus politischen Diskursen aufblitzen. LOVE A sind trotz aller Resignation auch um Hoffnung bemüht, um Auswege aus der permanenten Konfrontation, denn „rückwärts kommt niemand weiter, ganz alleine wird alles schwerer sein.“ Bei soviel inhaltlicher Schwere kommt es ebenso überraschend wie entspannend, wenn in „Monaco“ plötzlich eine TV-Figur aus längst vergangenen Tagen auftaucht, die spätestens bei Textzeilen wie „Immer das Geschiss mit der Elli“ nur der legendäre Monaco Franze von Helmut Dietl sein kann.
Nicht alle Songs auf dem Album sind durchgehend stark, aber die keineswegs rar gesäten Höhepunkte machen das locker wieder wett. Mit 41 Minuten Laufzeit hat „Nichts ist neu“ auch genau die richtige Länge, um nicht allzu viel Leerlauf aufkommen zu lassen. Und was ganz nebenbei ebenfalls erfreulich ist: LOVE A zeigen, wie man die deutsche Sprache auch einsetzen kann, ohne in Kraftmeierei zu verfallen oder in pseudo-tiefschürfendes Geseier wie in der Böhmermann-Parodie „Menschen Leben Tanzen Welt“. „Nichts ist neu“ gibt es auf CD und Vinyl (limitiert, teils mit Bonus-7“) und auf den gängigen Online-Plattformen. Auf dem Label-Kanal von Rookie Records auf YouTube ist das komplette Album außerdem kostenlos zum Probehören verfügbar.
- Stefan - 10/2019
 Über den Irrsinn, der sich Anfang der Neunziger in Norwegen
in der sich neu formierenden Black-Metal-Szene zutrug, ist viel
geschrieben worden, gerade unlängst in Zusammenhang mit dem Film „Lords
of Chaos“, der die nächste Stufe der medialen Weiterverarbeitung nach
Büchern und Dokumentation über dieses Thema darstellt. Eine Band, die
in in dieser Szene verwurzelt ist, allerdings erst nach dem Höhepunkt
der kriminellen Umtriebe in Erscheinung trat und sich immer wieder
musikalisch weit von ihren Anfängen entfernt hat, sind ULVER, die
bereits auf ihrem zweitem Album „Kveldssanger“ aus dem Jahr 1996 harte
Metal-Elemente aus ihrem Sound verbannte.
Über den Irrsinn, der sich Anfang der Neunziger in Norwegen
in der sich neu formierenden Black-Metal-Szene zutrug, ist viel
geschrieben worden, gerade unlängst in Zusammenhang mit dem Film „Lords
of Chaos“, der die nächste Stufe der medialen Weiterverarbeitung nach
Büchern und Dokumentation über dieses Thema darstellt. Eine Band, die
in in dieser Szene verwurzelt ist, allerdings erst nach dem Höhepunkt
der kriminellen Umtriebe in Erscheinung trat und sich immer wieder
musikalisch weit von ihren Anfängen entfernt hat, sind ULVER, die
bereits auf ihrem zweitem Album „Kveldssanger“ aus dem Jahr 1996 harte
Metal-Elemente aus ihrem Sound verbannte.
Folgerichtig ist „Kveldssanger“ ein rein akustisches Folk-Album mit Gitarren, Schlagzeug, Flöte und Cello. Neben dem Titel der Scheibe („Abendlieder“) zeigen auch Stücke wie „Naturmystikk“, wohin die Reise geht. Eine große Ruhe liegt in der über weite Strecken instrumentalen Platte, was nach dem metallischen Debut „Bergtatt“ ein zwar bemerkenswert eindeutiger, aber nicht vollkommen aus dem Nichts kommender Schritt war, denn bestimmte akustische Elemente fanden sich auch bereits auf dem Vorgängeralbum, das kein linientreuer Haudrauf-Black-Metal war. Sich von Metal-Gitarren und krächzendem BM-Gesang so nachhaltig zu trennen, um dann auf dem drittem Album plötzlich mit krachigem LoFi-Schwarzmetall genau das Gegenteil aufzunehmen, überraschte ebenfalls.

Was so alles unter dem Banner „Folk Metal“ segelt, kann ebenso grausig Mittelmäßiges ans Tageslicht bringen wie jene Kapellen, die sich als „Gothic Metal“ vermarkten. „Kveldssanger“ ist tatsächlich folkloristisch, ohne sich nur mit einem dekorativen Begleitelement zu schmücken. Dementsprechend hatte der Metal hier Sendepause, ohne dass mich aber die Folk-Klänge dazu inspiriert hätten, in Zukunft Handgetöpfertes oder selbstproduzierten Honig auf Mittelaltermärkten zu verkaufen. Die dunkle Seite dieser Musik, die über das naturmystische Element hinausgeht und sich in der Dokumentation „Until the Light takes us“ in den Passagen über die Kirchenbrände der frühen Neunziger und in den Einlassungen über die „wahre“ norwegische Kultur wiederfindet, soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, ist aber auch eine eigene und schon oft thematisierte Geschichte…
- Stefan - 11/2019

 Der britische Postpunk-Sound hat beim ZWNN über die Jahre
hinweg seine Spuren hinterlassen, sei es in Martins JOY
DIVISION-Huldigungen oder bei den Herbstmusik-Gastspielen von Bands wie
SIOUXSIE AND THE BANSHEES und BAUHAUS (unlängst in Los Angeles zum
ersten Mal seit vielen Jahren wieder live aufgetreten). THE SOUND aus
London, ebenfalls in den ausgehenden Siebzigern entstanden, hatten wir
dagegen noch nicht im Programm. Wie bei JOY DIVISION umgibt auch hier
den Frontmann eine tragische Aura: Sänger und Gitarrist Adrian Borland
war bereits in den Achtzigern an Depressionen erkrankt, elf Jahre nach
dem Ende von THE SOUND beging er Selbstmord.
Der britische Postpunk-Sound hat beim ZWNN über die Jahre
hinweg seine Spuren hinterlassen, sei es in Martins JOY
DIVISION-Huldigungen oder bei den Herbstmusik-Gastspielen von Bands wie
SIOUXSIE AND THE BANSHEES und BAUHAUS (unlängst in Los Angeles zum
ersten Mal seit vielen Jahren wieder live aufgetreten). THE SOUND aus
London, ebenfalls in den ausgehenden Siebzigern entstanden, hatten wir
dagegen noch nicht im Programm. Wie bei JOY DIVISION umgibt auch hier
den Frontmann eine tragische Aura: Sänger und Gitarrist Adrian Borland
war bereits in den Achtzigern an Depressionen erkrankt, elf Jahre nach
dem Ende von THE SOUND beging er Selbstmord.
Das zweite Album der Band „From the Lions Mouth“ sollte Anhängern von Joy Division und artverwandten Bands leicht zugänglich sein, bedient es sich doch der gleichen Zutaten: tieftrauriger Gesang, dominanter Bass, unterstützende Keyboards und sparsam eingesetzte Gitarren, die etwas dominanter werden, wenn das Tempo eines Stücks gelegentlich anzieht. THE SOUND mögen bisweilen ein wenig „leichtgängiger“ wirken als Ian Curtis und seine Mitstreiter, aber unbeschwert oder gar lebensfroh klingt hier dennoch nichts. Das komplette Album ist durchzogen von einer intensiven Melancholie, die einen spätestens mit „Judgement“, dem letzten Track auf der A-Seite, vollends gefangen nimmt…
 Noch besser ist die B-Seite des Albums: THE SOUND haben
sich hier endgültig warmgelaufen, bringen all ihre Stärken auf den
Punkt. Krönender Abschluss sind die letzten beiden Tracks „Silent Air“
und „New Dark Age“: Adrian Borlands Gesang könnte eindringlicher kaum
sein, die Musik bildet die perfekte Begleitung. „New Dark Age“ beginnt
düster, mit langsamen Trommelklängen, erhöht dann das Tempo, um wenig
später wieder das Anfangsthema aufzunehmen – nun unterstützt von
schrill-sägenden Gitarrenklängen, die an den unvergessenen John
McGeoch von Siouxsie and the Banshees erinnern. Warum THE SOUND
speziell mit diesem Album (38 Jahre alt und immer noch beeindruckend)
nicht den gleichen musikhistorischen Rang wie andere hier zitierte
Bands erlangen konnten, bleibt ein Rätsel – an mangelnder Qualität kann
es nicht gelegen haben. Mehr von THE SOUND (inklusive des vorliegenden
Albums sowie zahlreicher EP- und Radiosession-Tracks) gibt es als
kostengünstiges Boxset mit vier CDs, während die Suche nach einer
„Lions“-Vinyl-Ausgabe aktuell etwas teuerer ausfallen dürfte.
Noch besser ist die B-Seite des Albums: THE SOUND haben
sich hier endgültig warmgelaufen, bringen all ihre Stärken auf den
Punkt. Krönender Abschluss sind die letzten beiden Tracks „Silent Air“
und „New Dark Age“: Adrian Borlands Gesang könnte eindringlicher kaum
sein, die Musik bildet die perfekte Begleitung. „New Dark Age“ beginnt
düster, mit langsamen Trommelklängen, erhöht dann das Tempo, um wenig
später wieder das Anfangsthema aufzunehmen – nun unterstützt von
schrill-sägenden Gitarrenklängen, die an den unvergessenen John
McGeoch von Siouxsie and the Banshees erinnern. Warum THE SOUND
speziell mit diesem Album (38 Jahre alt und immer noch beeindruckend)
nicht den gleichen musikhistorischen Rang wie andere hier zitierte
Bands erlangen konnten, bleibt ein Rätsel – an mangelnder Qualität kann
es nicht gelegen haben. Mehr von THE SOUND (inklusive des vorliegenden
Albums sowie zahlreicher EP- und Radiosession-Tracks) gibt es als
kostengünstiges Boxset mit vier CDs, während die Suche nach einer
„Lions“-Vinyl-Ausgabe aktuell etwas teuerer ausfallen dürfte.
- Stefan - 11/2019
 Es hat schon etwas überhand genommen, dieses ganze
Okkultrock-Gedöns mit seinem mysteriösen Schnickschnack: zugepflastert
mit „bösen“ Symbolen, eingenebelt in Weihrauch, die Musiker versteckt
hinter Ein-Buchstabe-Pseudonymen oder unter Kapuzen. So scheint es auf
den ersten Blick auch im Fall der Schweden von ALASTOR zu sein, wobei
man sich erst einmal den Weg durch eine Kompanie gleichnamiger Bands
bahnen muss, gibt es doch gleich mehrere ALASTORs vorwiegend aus
Schwarzmetall-Gefilden von Chile bis Italien. Unsere Kandidaten
existieren seit drei Jahren und haben sich traditionellen Doom-Klängen
verschrieben, garniert mit einigen Psychedelic-Einflüssen.
Es hat schon etwas überhand genommen, dieses ganze
Okkultrock-Gedöns mit seinem mysteriösen Schnickschnack: zugepflastert
mit „bösen“ Symbolen, eingenebelt in Weihrauch, die Musiker versteckt
hinter Ein-Buchstabe-Pseudonymen oder unter Kapuzen. So scheint es auf
den ersten Blick auch im Fall der Schweden von ALASTOR zu sein, wobei
man sich erst einmal den Weg durch eine Kompanie gleichnamiger Bands
bahnen muss, gibt es doch gleich mehrere ALASTORs vorwiegend aus
Schwarzmetall-Gefilden von Chile bis Italien. Unsere Kandidaten
existieren seit drei Jahren und haben sich traditionellen Doom-Klängen
verschrieben, garniert mit einigen Psychedelic-Einflüssen.
Das vorliegende Album ist der erste Longplayer, dem zwei EPs
vorausgingen. Die große Erleuchtung findet auf „Slave to the Grave“
zwar (noch) nicht statt, doch die Scheibe ist besser und kurzweiliger
als zunächst vermutet. Die Herrschaften, die sich originellerweise „R“,
„S“, „J“ und „H“ nennen, haben mehr auf der Pfanne als die im Genre ja
nicht gerade seltenen Riff-Walzen, die ins Breitwandformat ausgedehnt
werden. Nach einem Intro in schwedischer Sprache geht’s los mit einem
Zehnminüter mit klassischem Doom, den man sich in etwa als musikalische
Schnittmenge aus gemäßigten ELECTRIC WIZARD und LORD VICAR vorstellen
kann. Auch der nächste Track „Drawn to the Abyss“ schlägt zunächst in
diese Kerbe, um in der Schlusspassage mit Orgel-Einsatz im Hintergrund
auf die Überholspur zu wechseln.

Auch einige Classic-Rock-Einflüsse finden sich auf der Scheibe,
gerade in „N.W. 588“ mit Gesangslinien, die an Nicke Andersson (THE
HELLACOPTERS) erinnern. In diesem Stück nimmt auch der
Psychedelic-Rock-Anteil größeren Raum ein, hier gibt es ausgedehntere
Soloabschnitte und weniger Rifflastiges. In eine völlig andere Richtung
biegt wiederum das akustische „Gone“ ab, das für zusätzliche
Abwechslung sorgt und mit acht Minuten Länge zwar recht ausgedehnt,
aber durchaus interessant arrangiert ist. Konservativer präsentiert
sich der Rest des Albums, wobei der Titeltrack leider kreative Flaute
verströmt. Weitaus besser ist da schon das abschließende, 17minütige
„The Spider of my Love“, das sich mit Frauengesang auch sehr gut als
Jex-Thoth-Nummer machen würde und schier nicht enden will. Ein
gelungener Ausklang für eine Scheibe, die einen nicht vor Begeisterung
niederknien lässt, aber dank zahlreicher guter Momente das Antesten
definitiv lohnt.
- Stefan - 11/2019

 Noch einmal zurück ins England der frühen Achtziger: Auch
KILLING JOKE brachten damals ihre ersten Platten heraus, im
vorliegenden Fall nach einer EP das erste vollständige Album. Das
Covermotiv ist ein Foto aus der nordirischen Stadt Derry und zeigt
Jugendliche, die nach Beschuss mit CS-Gas die Flucht ergreifen. Es
entstand nur wenige Monate vor jener Demonstration im Januar 1972, die
als sogenannter „Blutsonntag“ in die Geschichte einging.
Noch einmal zurück ins England der frühen Achtziger: Auch
KILLING JOKE brachten damals ihre ersten Platten heraus, im
vorliegenden Fall nach einer EP das erste vollständige Album. Das
Covermotiv ist ein Foto aus der nordirischen Stadt Derry und zeigt
Jugendliche, die nach Beschuss mit CS-Gas die Flucht ergreifen. Es
entstand nur wenige Monate vor jener Demonstration im Januar 1972, die
als sogenannter „Blutsonntag“ in die Geschichte einging.
Bei KILLING JOKE in der „richtigen“ Phase einzusteigen, ist abseits natürlich ebenfalls maßgeblicher individueller Geschmacksfragen nicht ganz einfach. Nur wenige Jahre nach dem vorliegenden Album traten sie mit eingängigen Songs wie „Eighties“ oder „Love like Blood“ in Erscheinung, die zugänglicher sind als das Material aus anderen Schaffensperioden. Beim Erstling ist die Musik teilweise sperriger, auch fehlt die bei anderen Post-Punk-Bands zu beobachtende melancholisch-melodische Komponente überwiegend.
 Auffallend ist auch, dass sich häufig ein mal schleppender,
mal nervös vorantreibender Rhythmus durch die Stücke zieht, der bis zum
Ende bestimmend bleibt. Eindrucksvoll lässt sich dies auf der A-Seite
bei Tracks wie „Wardance“ und „Tomorrow’s World“ nachvollziehen. Der
Opener der B-Seite trägt den Titel „The Wait“ und dürfte unter
Metal-Fans der bekannteste frühe KILLING JOKE-Song sein, coverten ihn
doch Metallica 1987 für die „$5.98 EP: Garage Days Re-Revisited“ (der
Vinyl-Einstand des damals neuen Bassisten Jason Newsted). Auch in der
zweiten Hälfte zieht sich die stilistische Doppelausrichtung durch das
Material: mal eingängig wie in „Complications“, dann wieder langsamer
und monotoner wie in „S.O.36“ oder dem großartigen Ausklang „Primitive“.
Auffallend ist auch, dass sich häufig ein mal schleppender,
mal nervös vorantreibender Rhythmus durch die Stücke zieht, der bis zum
Ende bestimmend bleibt. Eindrucksvoll lässt sich dies auf der A-Seite
bei Tracks wie „Wardance“ und „Tomorrow’s World“ nachvollziehen. Der
Opener der B-Seite trägt den Titel „The Wait“ und dürfte unter
Metal-Fans der bekannteste frühe KILLING JOKE-Song sein, coverten ihn
doch Metallica 1987 für die „$5.98 EP: Garage Days Re-Revisited“ (der
Vinyl-Einstand des damals neuen Bassisten Jason Newsted). Auch in der
zweiten Hälfte zieht sich die stilistische Doppelausrichtung durch das
Material: mal eingängig wie in „Complications“, dann wieder langsamer
und monotoner wie in „S.O.36“ oder dem großartigen Ausklang „Primitive“.
Bei der Wahl ihrer musikalischen Ausdrucksmittel war die Band auf
ihrem Debüt ziemlich minimalistisch unterwegs. Es gibt keine besonderen
stilistischen Ausflüge, keine Ausreißer, die sich andere in der
ZWNN-Herbstmusik früher besprochenen Bands wie BAUHAUS oder CHRISTIAN
DEATH geleistet haben. Gerade daraus gewinnt das Album aber seine
Qualität und wenn man es einmal vor dem Hintergrund später entstandener
Werke des Industrial Metal hört, wird schon recht deutlich, woher Bands
wie Ministry einige ihrer Einflüsse bezogen haben, auch wenn KILLING
JOKE im Jahr 1980 natürlich noch nicht diesen Härtegrad besaßen wie
ihre Nachfolger. Spätere Neuauflagen von „Killing Joke“ kommen mit
einigen Bonustracks im Gepäck, darunter unveröffentlichte Mixes und das
auf der Erstauflage nicht vertretene „Change“. Die Vinyl-Ausgaben
jüngeren Datums sind nicht nur bei Discogs recht teuer, sodass auch
eine CD-Version ihren Zweck erfüllt.
- Stefan - 11/2019
 Ein Jahr ist vergangen seit „Aqualung“ von Jethro Tull und
das in zweierlei Hinsicht: Anfang Dezember 2018 besprach Martin das
JT-Album von 1971 und ebenfalls ein Jahr später wurde 1972 die Scheibe
veröffentlicht, der wir uns diesmal widmen wollen. WISHBONE ASH sind
gerade im 50. Jahr seit ihrer Gründung 1969 unterwegs, wenn auch nicht
ununterbrochen und zudem von zahlreichen Besetzungswechseln begleitet.
Die frühen Jahre der Band werden von Kennern der Materie als eine
Mischung aus balladesken Tönen, im Folk verwurzelt, und moderatem
Hardrock beschrieben. Der markante Stil mit zwei Lead-Gitarren übte
einen hörbaren Einfluss auf Steve Harris aus, der sich instrumental
dann des Öfteren bei Iron Maiden wiederfand.
Ein Jahr ist vergangen seit „Aqualung“ von Jethro Tull und
das in zweierlei Hinsicht: Anfang Dezember 2018 besprach Martin das
JT-Album von 1971 und ebenfalls ein Jahr später wurde 1972 die Scheibe
veröffentlicht, der wir uns diesmal widmen wollen. WISHBONE ASH sind
gerade im 50. Jahr seit ihrer Gründung 1969 unterwegs, wenn auch nicht
ununterbrochen und zudem von zahlreichen Besetzungswechseln begleitet.
Die frühen Jahre der Band werden von Kennern der Materie als eine
Mischung aus balladesken Tönen, im Folk verwurzelt, und moderatem
Hardrock beschrieben. Der markante Stil mit zwei Lead-Gitarren übte
einen hörbaren Einfluss auf Steve Harris aus, der sich instrumental
dann des Öfteren bei Iron Maiden wiederfand.
Das Album „Argus“ war der dritte Longplayer der Band und es passt mit
seiner ruhigen, getragenen Atmosphäre geradezu maßgeschneidert in die
herbstliche Jahreszeit. Das liegt auch an dem angenehmen Sound der
Platte, der warm, einfühlsam und richtig schön organisch klingt, wie
beispielsweise „Sometime World“ oder „Blowin’ Free“ belegen. Vor diesem
Hintergrund betrachtet überrascht es keineswegs, dass Steve Harris in
diversen Dokumentationen und Interviews Wishbone Ash immer wieder als
eine Quelle der Inspiration zitierte, wenn man sich insbesondere die
Bass-Arbeit und die Twin-Gitarren zu Gemüte führt und sie dann in einen
musikalisch härter angelegten Metal-Kontext überträgt.

Die meisten Stücke auf „Argus“ sind auf eine längere Distanz von
sechs Minuten und mehr angelegt, was dem Wesen der Musik entspricht.
Bis auf einen Song wie „Warrior“ mit seinem mitreißenden Chorus ist
hier im Grunde nichts allzu offensichtlich auf einen Single-Hit hin
komponiert. Die Strukturen der Songs sind epischer angelegt und nehmen
sich die Zeit, die sie brauchen, ohne dabei unnötig abzudriften. Von
heute aus betrachtet ist „Argus“ zwar durch seine Produktion klanglich
in den Siebzigern zu verorten, hat aber dennoch etwas Zeitloses an
sich, das über eine auf ein bestimmtes Jahrzehnt beschränkte
Wahrnehmung hinausreicht.
Und auch wenn die Musik als solche nur am Rande des Hardrock-Genres
anzusiedeln ist, so könnte ein Klassiker wie „Warrior“ auch Fans von
epischem Breitwand-Metal wie BATHORY in ihrer mittleren Phase oder
Anhänger von MANILLA ROAD und Konsorten ansprechen. Das Sahnehäubchen
ist „Throw down the Sword“, ein direkt an „Warrior“ anschließender
Endpunkt, bei dem Gesang und Gitarrenarbeit sich noch einmal zu
großartiger Symbiose aufschwingen, bis das Album mit einem gefühlvollen
Solopart ausklingt. Auf den Neuauflagen ist danach aber noch lange
nicht Schluss: Neben einer Single-Disc-VÖ mit Bonustracks gibt es auch
eine Doppel-CD-Edition, die auf der zweiten Scheibe noch Livematerial
und Aufnahmen aus BBC-Radiosessions bereithält, einen Monat nach der
Albumveröffentlichung im Mai 1972 entstanden.
- Stefan - 12/2019

 Vollmundig hatte ich angekündigt, „On Dark Horses“ zu
besprechen, weil ich dachte, läuft gut als „Herbstmusik“ rein, nachdem
ich das Album zum ersten Mal in den Receiver gestreamt hatte. Es war
dann doch nicht so leicht, einen Zugang zu dem Gehörten zu bekommen,
weshalb ich nochmal zu ihrem ersten instrumentalen Solo-Album „Electric
Guitar One“ von 2011 zurückging, welches sie nach ihrer Mitarbeit am
bisher letzten Album der Post-Rock-Magier RED SPAROWES veröffentlicht
hatte. Der Sound ist, wie der Titel erahnen lässt, auf die Gitarre
beschränkt, die wie aus dem Nebel kommende Geräusche und Klänge
produziert, bei denen erkennbare Akkorde in heraufziehende Drones
übergehen. Höhepunkt des Albums ist für mich das letzte Stück, „The
Ecstasy in Thinking of Final Exits“, mit seinen hallenden Verzerrungen
und tranceartigem Dröhnen, um sich final in formloses elektrisches
Rauschen zu steigern, was sehr an die Phase aus Neil Youngs
Schaffen Anfang der 90er erinnert, in der er die noisige Sound-Collage
„Arc“ einspielte oder an seinen Soundtrack zu Jim Jarmuschs „Dead Man“.
Zu wissen, woher Emma Ruth Rundle kommt, vom puren Gitarrensound in
Moll, vervollständigte die Erfahrung des aktuellen Albums.
Vollmundig hatte ich angekündigt, „On Dark Horses“ zu
besprechen, weil ich dachte, läuft gut als „Herbstmusik“ rein, nachdem
ich das Album zum ersten Mal in den Receiver gestreamt hatte. Es war
dann doch nicht so leicht, einen Zugang zu dem Gehörten zu bekommen,
weshalb ich nochmal zu ihrem ersten instrumentalen Solo-Album „Electric
Guitar One“ von 2011 zurückging, welches sie nach ihrer Mitarbeit am
bisher letzten Album der Post-Rock-Magier RED SPAROWES veröffentlicht
hatte. Der Sound ist, wie der Titel erahnen lässt, auf die Gitarre
beschränkt, die wie aus dem Nebel kommende Geräusche und Klänge
produziert, bei denen erkennbare Akkorde in heraufziehende Drones
übergehen. Höhepunkt des Albums ist für mich das letzte Stück, „The
Ecstasy in Thinking of Final Exits“, mit seinen hallenden Verzerrungen
und tranceartigem Dröhnen, um sich final in formloses elektrisches
Rauschen zu steigern, was sehr an die Phase aus Neil Youngs
Schaffen Anfang der 90er erinnert, in der er die noisige Sound-Collage
„Arc“ einspielte oder an seinen Soundtrack zu Jim Jarmuschs „Dead Man“.
Zu wissen, woher Emma Ruth Rundle kommt, vom puren Gitarrensound in
Moll, vervollständigte die Erfahrung des aktuellen Albums.
Die nachfolgenden Solo-Alben „Some Heavy Ocean“ (2014), „Marked For Death“ (2016) und eben „On Dark Horses“ sind nicht mehr rein instrumental, Emma Ruth Rundle singt ihre Texte hier selbst, und scheint dabei auf persönlichen Erfahrungen und innere Konflikte zurückzugreifen und somit durch eine Art psychotherapeutischen Prozess Kunst zu erschaffen, ohne den Hörer in einen Depressions-Sumpf zu ziehen, denn „In the wake of weak beginnings, we can still stand high“, wie es in „Darkhorse“ heißt, und die Künstlerin sagt zum Tenor des Albums: „The record is about overcoming - understanding and embracing the crippling situation and then growing beyond it.“

„On Dark Horses“ ist mehr als die Vorgänger band-orientiert, hat daher nicht mehr ganz die intime Härte und wirkt vorgeblich etwas leichter und zugänglicher. Jedoch ließ mich das Album beim ersten Hören am Stück etwas ratlos zurück. Die Stücke mussten einzeln und mit Pausen gehört werden – meist nur einen oder zwei Tracks abends zum Tagesabschluss - und dann erschloss sich das große Ganze.
Emma Ruth Rundle könnte auch in einer Folk-Band spielen, sie selbst sagt auch, dass sie alle Songs auf der Akustik-Gitarre komponiert und erst dann die Effekt-Pedale an die E-Gitarre anschließt. „I am just a person making noise - sometimes its folk sometimes it’s not“, meint sie dazu. Ihre Stimme driftet nie in Ätherische oder gar Liebliche ab, sondern hält den Zuhörer trotz aller Schönheit in der Realität. Vielleicht wie eine durch die Handarbeit an der Gitarre geerdetere Tori Amos, die einen mehr oder weniger starken Hang zum Überdrehten hat - nicht, dass dies per se negativ wäre.
Das Album hat oft eine fiebrige Atmosphäre, manchmal wirkt es verträumt, aber kaum hat man sich versehen, greift „On Dark Horses“ tief rein, zeigt, dass man sich nicht täuschen lassen sollte, wenn gerade noch eine melancholisch dahinfließende Gesangsmelodie eine subtile Wendung nimmt und Gefühle bei einem auslöst, die man in ihrer schmerzlichen Schönheit erst einmal einordnen muss, so geschehen bei „Apathy on the Indiana Border“. Bei „Dead Set Eyes“ bekommt der Postrock-Doom-Folk, wenn man ein wackliges Regalbrett für den Stil von Emma Ruth Rundle zimmern möchte, einen schleppenden, reduzierten Blues-Einschlag. Sollte man einen Anspieltip geben, würde ich „Darkhorse“ nennen, unten in der Live-Version auf KEXP.
Alle Alben von Emma Ruth Rundle findet man bei Bandcamp zum Anhören, und wenn man sie dort runterlädt (für die Audiophilen: auch in FLAC), bekommen die Künstler einen Großteil des dafür gezahlten Geldes.
- Martin - 12/2019
 Wohl selten zuvor wurden (Liebes-)Leid und Melancholie in
eine derart wunderschöne, metallisch legierte Form gegossen! Anders als
bei den frühen Iced Earth zum Beispiel bestimmt hier nicht eine
permanente depressive Dauerunterfütterung das Klangbild, eine Art
"Eiseskälte" wie bei den späten Bathory kommt hier auch nicht auf, und
von dem seelengepeinigten Gejammere vieler Doom Bands ist hier auch
nichts zu spüren. Vielmehr schimmern im Falle von Lillian Axe bei aller
immanenten Traurigkeit doch immer noch genügend Trotz und Zuversicht
durch, so daß es immer wieder eine reine Freude ist, sich diese Scheibe
zu Gemüte zu führen. Und dies im wahrsten Sinn des Wortes…
Wohl selten zuvor wurden (Liebes-)Leid und Melancholie in
eine derart wunderschöne, metallisch legierte Form gegossen! Anders als
bei den frühen Iced Earth zum Beispiel bestimmt hier nicht eine
permanente depressive Dauerunterfütterung das Klangbild, eine Art
"Eiseskälte" wie bei den späten Bathory kommt hier auch nicht auf, und
von dem seelengepeinigten Gejammere vieler Doom Bands ist hier auch
nichts zu spüren. Vielmehr schimmern im Falle von Lillian Axe bei aller
immanenten Traurigkeit doch immer noch genügend Trotz und Zuversicht
durch, so daß es immer wieder eine reine Freude ist, sich diese Scheibe
zu Gemüte zu führen. Und dies im wahrsten Sinn des Wortes…
Anders als bei ihren späteren, von einer recht düsteren Grundschattierung durchzogenen Werken ab "Waters rising" (2008) gelang es der Band in ihrer Frühphase mit Sänger Ron Taylor geradezu perfekt, ihrer programmatisch innewohnenden Melancholie doch immer noch ein Quentchen "Frohsinn" beizumischen, was ihnen wohl auch – zusammen mit den zeittypischen bunt-peinlichen Outfits der späten Achtziger – ihr dubioses und vor allem äußerst unzutreffendes Poser-Image einbrachte.
"Psychoschizophrenia" von 1993 ist eines dieser wirklich bewegenden Alben, das wohl auch die meisten unserer Leser kennen dürften. Für mich immer noch unübertroffen ist - trotz genialer Folgealben wie "Love & War" oder "Poetic Justice" - ihr selbstbetiteltes Debüt von 1988, auf dem zwischen dem flott kickenden Opener "Dream of a Lifetime" und dem fröhlich-aggresiven Rausschmeißer "Laughing in your Face" ein wahres Kaleidoskop männlichen Empfindens abgefeiert wird, ohne dabei in allzu düstere Gefilde abzudriften. Grundtenor: Ungerechtigkeit, Leiden und Scheitern gehören ebenso zum Leben wie Sich-Verzehren, Erfüllung und Glückseligkeit, und in manchen Lebenslagen darf man durchaus auch mal selbstzerfleischend oder gar gehässig sein… Dazu der Sahnegesang von Mr. Taylor und die allzeit präsenten packenden Riffs, Licks und Soli von Stevie Blaze, eine tighte Rhythmusfraktion und Songs für die Ewigkeit… `nuff said I guess!
Inzwischen ist mir auch klar, warum ich diese Platte bevorzugt zur Seelenstabilisierung oder eben im Herbst so gerne auflege. Sie kommt aber zu jeder Jahreszeit gut – ein echter Klassiker!
- Klaus - 12/2019

 Eigentlich galten CELTIC FROST ja als zu Grabe
getragen, denn 1990 war das letzte Studioalbum erschienen, danach gab
es noch eine Compilation und ein Demo (1993), bevor sich die Band
auflöste. Nicht endgültig, denn in den frühen 2000er Jahren waren erste
neue Lebenszeichen zu vermelden. Schade, dass „Prototype“ (ein Demo mit
äußerst eigenartigen stilistischen Ausflügen) nie offiziell das Licht
der Welt erblickte – der Katastrophentourist in mir wäre vermutlich
begeistert gewesen, wie sehr die Traditionalisten unter den CF-Fans
abgekotzt hätten angesichts eines Tracks wie „Hip Hop Jugend“, den man
gehört haben muss, um an seine Existenz zu glauben.
Eigentlich galten CELTIC FROST ja als zu Grabe
getragen, denn 1990 war das letzte Studioalbum erschienen, danach gab
es noch eine Compilation und ein Demo (1993), bevor sich die Band
auflöste. Nicht endgültig, denn in den frühen 2000er Jahren waren erste
neue Lebenszeichen zu vermelden. Schade, dass „Prototype“ (ein Demo mit
äußerst eigenartigen stilistischen Ausflügen) nie offiziell das Licht
der Welt erblickte – der Katastrophentourist in mir wäre vermutlich
begeistert gewesen, wie sehr die Traditionalisten unter den CF-Fans
abgekotzt hätten angesichts eines Tracks wie „Hip Hop Jugend“, den man
gehört haben muss, um an seine Existenz zu glauben.
Nach Jahren der Arbeit in Eigenregie war es 2006 so weit: „Monotheist“ wurde veröffentlicht und es schien der Beginn eines zweiten (oder dritten) Frühlings von Celtic Frost zu sein. Aber passen Erblühen und Optimismus überhaupt zu dieser Band? Jedenfalls sollte das Comeback-Album der Schweizer auch das letzte sein, denn von zwischenmenschlichen Animositäten zermahlen war 2008 das endgültige Aus gekommen. Der plötzliche Tod von Bassist Martin Eric Ain (2017) mit gerade einmal 50 Jahren setzte einen weiteren Schlusspunkt unter das Erbe von Celtic Frost.
Es war spannend mitzuverfolgen, wie sich die Band im Jahr 2006 präsentieren würde. Auf Nummer Sicher hatten CF ja im Grunde nur selten gesetzt, mit „Cold Lake“ hatten sie sogar einen beträchtlichen Teil ihrer Anhänger verprellt, die den Weg auf „Into the Pandemonium“ noch mitgegangen waren. Nach langen Jahren der Funkstille kam dann „Monotheist“: ein tiefschwarzer Brocken, phasenweise schleppend und schwer verdaulich. Die Band hatte offensichtlich an früheren Headbanger-Krachern wie „Circle of the Tyrants“ kaum mehr Interesse, auch wenn Elemente davon auf „Monotheist“ sehr wohl auftauchen. Was dominiert, sind zentnerschwere Doom-Passagen und ein Sound, der die Strecke verdeutlicht, die CF seit den ebenfalls sehr wechselhaften Achtzigern zurückgelegt hatten. Auch wenn alteingesessene Fans mit „Monotheist“ mitunter nicht mehr viel anzufangen wussten, konnte man der Band zumindest keinen Aufguss von Altbekanntem vorwerfen.

Je weiter „Monotheist“ voranschreitet, umso schwerer und erdrückender wird die Stimmung, besonders in den letzten drei Stücken „Totengott“, „Synagoga Satanae“ und „Winter“. Ich kann gut nachvollziehen, wenn manche CF-Anhänger hier aussteigen, weil sie die Musik als zu langgezogen und damit monoton empfinden. Die Band verlässt sich hier ganz auf die Wirkung ihres Sounds und weniger auf kompositorische Finessen, wenn ein Stück auch schon mal auf über 14 Minuten ausgedehnt wird. An Intensität mangelt es dagegen nicht, keine Frage. So ist es nach all der Schwere der vorangegangenen Stunde durchaus sehr angenehm, wenn die verbleibenden Minuten von „Monotheist“ in einem rein instrumentalen Outro mit klassischer Musik ausklingen.
Nur relativ kurze Zeit später brach die Band 2008 in sich zusammen, wie in einer Dokumentation des Schweizer Fernsehens festgehalten. Die ohnehin schwierigen persönlichen Beziehungen führten dazu, dass Celtic Frost nicht weiterzubestehen vermochten. Ein Teil des Erbes lebt in Tom Fischers Band TRIPTYKON weiter, die zwar zu Anfang sogar mit Stücken, die noch für CF geschrieben wurden, die musikalische Substanz von „Monotheist“ fortführt, sie aber bislang für meinen Geschmack nicht auf ein neues Level heben konnte.
There
is no God but the one that dies with me. I have no life but the one I
take with me to the grave.
We come into this world alone. And we
will die on our own. (aus "Ain Elohim")
- Stefan - 12/2019