
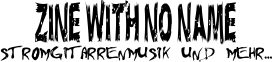

„The world is full of
Kings and Queens
Who blind your
eyes then steal your dreams.“
(BLACK SABBATH – Heaven And Hell)
 Kurz vor seinem Tod Ende August war Eric Wagner, der
Doom-Gemeinde als ehemaliger TROUBLE-Sänger in bester Erinnerung, noch
mit seiner Band THE SKULL auf Tour gewesen, bevor ihn dann eine
Covid-Erkrankung dahinraffte. Offenbar aus Überzeugung ungeimpft eine
Konzertreise anzutreten, war ein im Nachhinein betrachtet zu hohes
Risiko. Auch wenn Wagner meines Wissens nicht (zumindest öffentlich) in
absurde Schwurbelgefilde abdriftete wie sein Doom-Kollege Scott „Wino“
Weinrich von THE OBSESSED, fragt man sich schon, welchen höheren Wert
eine angebliche „Prinzipientreue“ eigentlich haben soll, wenn sie am
Ende nur zu einem unnötig frühen Tod führt, weil unbedingt der bösen
„Schulmedizin“ widersprochen werden musste.
Kurz vor seinem Tod Ende August war Eric Wagner, der
Doom-Gemeinde als ehemaliger TROUBLE-Sänger in bester Erinnerung, noch
mit seiner Band THE SKULL auf Tour gewesen, bevor ihn dann eine
Covid-Erkrankung dahinraffte. Offenbar aus Überzeugung ungeimpft eine
Konzertreise anzutreten, war ein im Nachhinein betrachtet zu hohes
Risiko. Auch wenn Wagner meines Wissens nicht (zumindest öffentlich) in
absurde Schwurbelgefilde abdriftete wie sein Doom-Kollege Scott „Wino“
Weinrich von THE OBSESSED, fragt man sich schon, welchen höheren Wert
eine angebliche „Prinzipientreue“ eigentlich haben soll, wenn sie am
Ende nur zu einem unnötig frühen Tod führt, weil unbedingt der bösen
„Schulmedizin“ widersprochen werden musste.
 Ebenso wie mit THE SKULL nahm Eric Wagner auch mit
BLACKFINGER zwei Alben auf, die nicht unbedingt an den Nimbus der
TROUBLE-Jahre anknüpfen konnten, aber gutklassigen Doom Metal boten,
den man immer wieder mal auflegen kann. Anfang 2014 kam das Debütalbum
auf den Markt, veröffentlicht vom deutschen Doom-Qualitätslabel The
Church Within Records – unter anderem bekannt durch Bands wie ORCHID,
LORD VICAR oder REVEREND BIZARRE.
Ebenso wie mit THE SKULL nahm Eric Wagner auch mit
BLACKFINGER zwei Alben auf, die nicht unbedingt an den Nimbus der
TROUBLE-Jahre anknüpfen konnten, aber gutklassigen Doom Metal boten,
den man immer wieder mal auflegen kann. Anfang 2014 kam das Debütalbum
auf den Markt, veröffentlicht vom deutschen Doom-Qualitätslabel The
Church Within Records – unter anderem bekannt durch Bands wie ORCHID,
LORD VICAR oder REVEREND BIZARRE.
Im Vergleich zum Nachfolger „When Colors fade away“ von 2017 besticht der Erstling durch eine stellenweise etwas ruhigere Gangart mit sehr gelungenen balladesken Momenten, die dem Album eine größere stilistische Bandbreite verleihen und ihm mehr Tiefe geben. Besonders ein Song wie „For one more Day” ist hier herauszuheben. Sein Text entfaltet unter dem Eindruck von Wagners Ableben mit Zeilen wie „I’m so sorry we didn’t get the chance to say goodbye” oder „With all my heart and all my soul grow old with me” mit dem heutigen Wissen gehört noch einmal besondere Kraft, auch wenn der Anlass ein trauriger ist.
Aktuell scheint das Album zumindest auf CD vergriffen zu sein und die LP-Preise zumindest bei Discogs liegen jenseits der Schallmauer (außer vielleicht für die Geld-spielt-keine-Rolle-Fraktion). Wer auch mit der digitalen Variante leben kann, der wird bei Bandcamp fündig: https://blackfinger-cwr.bandcamp.com
- Stefan - 10/2021
 Eigentlich hätte ich die Band BLOOD CEREMONY bei einer
spontanen Selbstbefragung als Briten verortet, doch tatsächlich stammen
die drei Herren und die eine Dame aus Kanada. Bei aller territorialen
Verirrung lässt die Musik selbst keine Unklarheiten offen: In einem
Genre mit überreichem Angebot hat sich „The Eldritch Dark“, der dritte
Longplayer der im Jahr 2006 gegründeten Formation, als dauerhaft gut
und grundsolide entpuppt. Rockbands mit Frauen am Mikro und
ausgeprägten Seventies-Einflüssen gibt es ja nun zweifelsohne eine
ganze Menge und nicht alles davon hat sich wie auch bei anderen
Stilrichtungen als beständig erwiesen.
Eigentlich hätte ich die Band BLOOD CEREMONY bei einer
spontanen Selbstbefragung als Briten verortet, doch tatsächlich stammen
die drei Herren und die eine Dame aus Kanada. Bei aller territorialen
Verirrung lässt die Musik selbst keine Unklarheiten offen: In einem
Genre mit überreichem Angebot hat sich „The Eldritch Dark“, der dritte
Longplayer der im Jahr 2006 gegründeten Formation, als dauerhaft gut
und grundsolide entpuppt. Rockbands mit Frauen am Mikro und
ausgeprägten Seventies-Einflüssen gibt es ja nun zweifelsohne eine
ganze Menge und nicht alles davon hat sich wie auch bei anderen
Stilrichtungen als beständig erwiesen.
Ein wenig Weihrauchgewaber, okkult anmutende visuelle Gestaltung, Zitate aus alten Horrorstreifen der Sechziger und Siebziger, musikalische Zutaten aus jener Zeit sowie ein entsprechendes Erscheinungsbild und fertig ist der Retro-Zauber. Zugegeben, etwas gehässig mag das jetzt schon klingen und ähnliche Elemente finden sich auch bei BLOOD CEREMONY und dem vorliegenden Album wieder, aber die Band macht eben etwas Gelungenes daraus und versinkt nicht identitätslos im rückwärtsgewandten Klischeesumpf.
 Ganz grob ließe sich die Musik zwischen Jethro
Tull und klassischem Siebziger-Doom einordnen, wodurch Black Sabbath
als Bezugspunkt nicht unerwähnt bleiben können. Erfreulich ist der
musikalische Aufbau des Longplayers: mal flotter arrangiert wie beim
Video-Track „Goodbye Gemini“, dann wieder etwas ruhiger und
midtempoorientiert für die entspannteren Momente. Auch eine reine
Ballade wie „Lord Summerisle“ (remember THE WICKER MAN?), gesungen von
Bassist Lucas Gadke, passt wunderbar ins Bild, wobei vergleichbare
Songs von frühen Sabbath-Alben hier ebenso Pate gestanden haben dürften
wie Werke aus der britischen Folk-Szene der
Siebzigerjahre.
Ganz grob ließe sich die Musik zwischen Jethro
Tull und klassischem Siebziger-Doom einordnen, wodurch Black Sabbath
als Bezugspunkt nicht unerwähnt bleiben können. Erfreulich ist der
musikalische Aufbau des Longplayers: mal flotter arrangiert wie beim
Video-Track „Goodbye Gemini“, dann wieder etwas ruhiger und
midtempoorientiert für die entspannteren Momente. Auch eine reine
Ballade wie „Lord Summerisle“ (remember THE WICKER MAN?), gesungen von
Bassist Lucas Gadke, passt wunderbar ins Bild, wobei vergleichbare
Songs von frühen Sabbath-Alben hier ebenso Pate gestanden haben dürften
wie Werke aus der britischen Folk-Szene der
Siebzigerjahre.
Besonders effektiv kommen die Stärken der
Scheibe bei „Ballad of the Weird Sisters“ und dem Titelsong zur
Geltung: Flöte und Orgel sind gleichberechtigt neben klassischer
Rock-Gitarre mit knackigen Riffs platziert, eingebettet in schlicht und
ergreifend gutes Songwriting. BLOOD CEREMONY haben verstanden, dass
Retro-Attitüde allein eben nicht genügt – es steht und fällt alles mit
einprägsamen Songs. Daran herrscht auf „The Eldritch Dark“ kein Mangel,
auch wenn es hier nicht den einen ganz großen, hitverdächtigen
Ausnahmetrack gibt, an dem man sich freilich recht schnell auch wieder
sattgehört haben kann. Hat auf der anderen Seite den angenehmen
Nebeneffekt, dass „The Eldritch Dark“ auch acht Jahre nach
Veröffentlichung als Album immer noch funktioniert.
Video
"Summerisle" - geht nur extern
Video
"Eldritch Dark" - geht nur extern
- Stefan - 10/2021

 Kenner des abseitigen französischen Films werden mit den
verschrobenen, eigenwilligen Filmen von Jean Rollin vertraut sein:
häufig mit Vampir-Thematik, aber derart weit weg vom leicht
konsumierbaren Mainstream, dass nur eine kleine, aber umso treuere
Fangemeinde damit etwas anfangen kann. Das Album „Les Enfants du
Cimetière“ (zu Deutsch „Die Kinder des Friedhofs“) von PONCE PILATE
weckt ähnliche Eindrücke – ganz so, als wäre man dieser Tage mit einem
alten Renault R4 in der nebelverhangenen französischen Provinz
unterwegs, um von Friedhof zu Friedhof zu fahren und nach Drehorten
alter Rollin-Filme zu suchen.
Kenner des abseitigen französischen Films werden mit den
verschrobenen, eigenwilligen Filmen von Jean Rollin vertraut sein:
häufig mit Vampir-Thematik, aber derart weit weg vom leicht
konsumierbaren Mainstream, dass nur eine kleine, aber umso treuere
Fangemeinde damit etwas anfangen kann. Das Album „Les Enfants du
Cimetière“ (zu Deutsch „Die Kinder des Friedhofs“) von PONCE PILATE
weckt ähnliche Eindrücke – ganz so, als wäre man dieser Tage mit einem
alten Renault R4 in der nebelverhangenen französischen Provinz
unterwegs, um von Friedhof zu Friedhof zu fahren und nach Drehorten
alter Rollin-Filme zu suchen.
Im Autoradio liefe dann dieses obskure Album, das die Band im Jahr 1985
im Eigenverlag als LP veröffentlichte. Nur 500 Exemplare hat es
seinerzeit davon gegeben, von denen heutzutage naturgemäß nur noch
schwer eines zu zivilem Preis aufzutreiben sein dürfte. Abhilfe schuf
vor Jahren eine CD-Neuauflage mit Bonustracks, sodass es sich nicht
mehr nur um eine sagenumwobene Rarität handelt. Die Musik von PONCE
PILATE zu kategorisieren, ist keine leichte Aufgabe, denn die Band,
deren Kern aus zwei Musikern bestand, streift zwar durch Einflüsse aus
diversen Ecken, entwickelt dabei aber dennoch einen eigenständigen
Charakter.
Zeitgenössisch, also eng angebunden an damals populären straighten
Metal, klingen PONCE PILATE eher selten, auch das Tempo wird nur
gelegentlich angezogen. Der etwas dünne Gitarrensound ist keine
Metal-Dampfwalze, sondern mehr in den Siebzigerjahren zu Hause. Ein
akustisches Intermezzo mit dem Titel „Laetitia“ erinnert an ähnliche
Songs, wie sie Black Sabbath in frühen Jahren komponierten, der
geschickt aufgebaute Track „Ponce Pilate“ beginnt mit Klavier und
Gesang, um erst in den letzten zwei Minuten richtig an Fahrt
aufzunehmen, wobei im Hintergrund die Keyboards den
Siebziger-Prog-Hardrock wiederaufleben lassen. Was nicht verwundert,
denn Bands aus dieser Zeit wie Deep Purple, Yes und Genesis (zu
Peter-Gabriel-Zeiten), aber auch Black Sabbath und alte Scorpions (mit
Uli Jon Roth) zählten zu den Einflüssen der beiden Franzosen.

Mit einem Stilmix dieser Art, der eine klassische
Metal-Erwartungshaltung nur eingeschränkt bedient, und den spärlichen
Möglichkeiten, eine LP im Eigenverlag zu vertreiben, war kommerziell
gesehen kein Staat zu machen und so löste sich die Band dann auch recht
bald auf, nachdem das einzige Album veröffentlicht war. Was bleibt, ist
ein kauziges Kleinod des französischen Hardrock, das seine zwei großen
Highlights ganz am Ende platziert: Die Ballade „Morphine Queen“
(hervorragend) und das von den französischen Landsleuten TENTATION in
einer deutlich metallischeren Version gecoverte „Les Anges de
Balthazar“.
Wer beim nächsten Frankreichurlaub den unstillbaren Drang verspüren
sollte, jenen Ort aufzuspüren, an dem die mysteriösen Bandfotos für das
vorliegende Album entstanden sind, der sollte dem Friedhof der kleinen
Gemeinde Cour-Cheverny in Zentralfrankreich einen Besuch abstatten.
Dort rückte einst die Band an einem Ostersonntag ein, um sich mit
Kapuzenmänteln und anderem Schnickschnack ablichten zu lassen. Das
Resultat passte perfekt zur Musik und unterstrich die Sonderstellung
eines Albums, für das eine abgedroschene Vokabel wie „obskur“ wirklich
einmal angemessen erscheint und zugleich als Kompliment verstanden
werden darf.
- Stefan - 10/2021
 Es gibt nicht viele phantastische Filme aus
Belgien, die internationalen Erfolg für sich verbuchen konnten.
Regisseur Harry Kümel schuf zwei von ihnen: die Jean-Ray-Verfilmung
„Malpertuis“ (1972) mit Orson Welles und Mathieu Carrière sowie im Jahr
zuvor den erotisch aufgeladenen Vampirfilm „Blut an den Lippen“, im
englischsprachigen Raum unter dem Titel „Daughters of Darkness“
bekannt. Ein junges Paar auf seiner Hochzeitsreise findet darin den Weg
in ein Hotel in Ostende, wo sich kaum jemand aufhält, denn es ist
Nachsaison – die üblichen Touristen sind längst wieder nach Hause
zurückgekehrt. Nur ein älterer Portier und zwei bemerkenswerte Frauen
befinden sich noch an diesem Ort…
Es gibt nicht viele phantastische Filme aus
Belgien, die internationalen Erfolg für sich verbuchen konnten.
Regisseur Harry Kümel schuf zwei von ihnen: die Jean-Ray-Verfilmung
„Malpertuis“ (1972) mit Orson Welles und Mathieu Carrière sowie im Jahr
zuvor den erotisch aufgeladenen Vampirfilm „Blut an den Lippen“, im
englischsprachigen Raum unter dem Titel „Daughters of Darkness“
bekannt. Ein junges Paar auf seiner Hochzeitsreise findet darin den Weg
in ein Hotel in Ostende, wo sich kaum jemand aufhält, denn es ist
Nachsaison – die üblichen Touristen sind längst wieder nach Hause
zurückgekehrt. Nur ein älterer Portier und zwei bemerkenswerte Frauen
befinden sich noch an diesem Ort…
Eine gewisse Gräfin Bathory (Delphine Seyrig) hat sich mit ihrer Dienerin Ilona (Andrea Rau) in dem Hotel niedergelassen und wir erfahren schnell, dass die beiden Damen (in ihrer Erscheinung von Regisseur Kümel wie Marlene Dietrich und Louise Brooks inszeniert) keine normalen Gäste sind. Die Gräfin ist eine Vampirin, die auf weibliche Begleitung Wert legt. Als in der Umgebung diverse Morde geschehen, mit jungen blutleeren Frauen als Opfer, ist das frischvermählte Paar der betörenden Gräfin Bathory längst ins Netz gegangen. Es werden weitere Menschen sterben…
Was Regisseur Kümel mit großer Kunstfertigkeit zu einem sehr
atmosphärischen Horrorfilm machte, vollendete Francois de Roubaix mit
seiner Filmmusik. Der Franzose, der schon wenige Jahre später im
November 1975 bei einem Tauchunfall starb, hatte damals bereits die
Soundtracks zu Klassikern wie „Der eiskalte Engel“ mit Alain Delon
komponiert und ist auch nach Jahrzehnten in der Popkultur lebendig
geblieben. Ein Thema aus seinem Score zu „Der Kommissar und sein
Lockvogel“ mit Lino Ventura zum Beispiel fand als Sample Eingang in
einen Track von Robbie Williams und auch eine französische TV-Doku
erinnerte an Roubaix.

Die Musik zu „Blut an den Lippen“ legt sich perfekt als stimmungsvoller Klang unter die Bilder und greift die zauberhafte Stimmung des Films (die sich nach den Erinnerungen von Andrea Rau bereits am Set spüren ließ) in kongenialer Weise auf. Streicher und Klavier prägen den Score ebenso wie folkloristisch anmutende Elemente und man fühlt sich beim Hören sofort an den Ort des mysteriösen Geschehens versetzt. Altes Hotelgemäuer mit seinen zahlreichen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten ist ohnehin ein Fall für sich und das entrückt wirkende Flair der Nachsaison mit fühlbarer Vergänglichkeit tut sein Übriges.
Verschiedene musikalische Motive der Musik werden von Multiinstrumentalist Roubaix in abgewandelter Form mehrfach aufgegriffen, wobei es ihm meisterhaft gelingt, auch Klänge einzusetzen, die nicht dem Klischee von traditioneller Horrorfilm-Schockmusik entsprechen. Teilweise fühlt man sich musikalisch sogar wie auf einen gruselig-traumhaften Jahrmarkt versetzt, bevor akzentuierte Streicher und Klavier wieder die vampiristische Bedrohung aufgreifen, die von Gräfin Bathory ausgeht. Diese Vielseitigkeit prägte das gesamte Schaffen von Francois de Roubaix, der Musik für ein traurig endendes Krimi-Drama ebenso überzeugend komponieren konnte wie den Score für eine turbulente Komödie mit Louis des Funès. Mit seiner Arbeit für „Daughters of Darkness“ hat er auch im Horrorfilm einen großartigen, bleibenden Eindruck hinterlassen.
-Stefan - 10/2021

 Vor 30 Jahren nahm jenes Verbrechen seinen Lauf, dessen
Ausläufer wir im Metal-Sektor noch heute spüren: der hinterhältige Mord
am Schwermetall, der dahingemeuchelt wurde von einer eierlosen
„Jammermusik“ namens Grunge. Diese Dolchstoßlegende hält sich ja bis
heute hartnäckig und wird von Metal-Journalisten sogar bis ins
Privatleben ausgedehnt. Damals in den schlimmen Neunzigern habe die
holde Weiblichkeit ja jeden abgelehnt, der nach Metaller aussah und
nicht wie ein Alternative-Rock-Zausel. Nun, es mag vielleicht auch an
dem Umstand gelegen haben, dass bierbäuchige Zeitgenossen mit
verwaschenen Manowar-Shirts nicht unbedingt das große, schier
unwiderstehliche Geschenk der (männlichen) Menschheit an die Frauen
gewesen sind – aber das nur am Rande.
Vor 30 Jahren nahm jenes Verbrechen seinen Lauf, dessen
Ausläufer wir im Metal-Sektor noch heute spüren: der hinterhältige Mord
am Schwermetall, der dahingemeuchelt wurde von einer eierlosen
„Jammermusik“ namens Grunge. Diese Dolchstoßlegende hält sich ja bis
heute hartnäckig und wird von Metal-Journalisten sogar bis ins
Privatleben ausgedehnt. Damals in den schlimmen Neunzigern habe die
holde Weiblichkeit ja jeden abgelehnt, der nach Metaller aussah und
nicht wie ein Alternative-Rock-Zausel. Nun, es mag vielleicht auch an
dem Umstand gelegen haben, dass bierbäuchige Zeitgenossen mit
verwaschenen Manowar-Shirts nicht unbedingt das große, schier
unwiderstehliche Geschenk der (männlichen) Menschheit an die Frauen
gewesen sind – aber das nur am Rande.
Der Ursprung des vorliegenden Albums geht zurück ins Frühjahr 1990, als
Andrew Wood (Sänger von MOTHER LOVE BONE) an den Folgen einer Überdosis
starb. Sein Wegbegleiter Chris Cornell (SOUNDGARDEN) nahm mit anderen
Freunden, die zum Kern von PEARL JAM wurden, eine LP im Gedenken an
Wood auf, die dann im Zuge der Grunge-Euphorie selbst zum Hit wurde.
Soweit die bekannten musikhistorischen Fakten. Mittlerweile ist auch
Chris Cornell verstorben, was die Scheibe zusätzlich belastet oder mit
Tiefgang versieht, je nach Sichtweise. In jedem Fall ist „Temple of the
Dog“ kein Allstar-Projekt mit Grunge-Koryphäen, von geschäftstüchtigen
Plattenfirmen-Managern zusammengestellt, sondern von der Trauer um
einen verstorbenen Freund geprägt, was sich in den Songtexten ebenso
äußert wie in der allgegenwärtigen Stimmung des Albums und somit gar
keine Unbeschwertheit transportieren kann.
 Dadurch mag „Temple of the Dog“ auf den ersten Eindruck
stellenweise nur wenig zugänglich wirken, etwa wenn ein
jamsessionartiger Elfminüter wie „Reach Down“ gleich an die zweite
Position gesetzt wird, wo er im Sinne eines durchkalkulierten
Hit-Albums eigentlich eher „stören“ würde. Aber dann folgen ja bereits
„Hunger Strike“ mit Gastsänger Eddie Vedder, die balladesken Stücke
„Call me a Dog“ und „Times of Trouble“ und alles ist gut. Es mag sein,
dass diese Art von Musik keine ausgelassene Party-Stimmung versprüht,
jede Fröhlichkeit vermissen lässt, aber das über Jahre anhaltende
Bashing als vermeintliche Depri-Mucke seitens „echter“ Rocker nahm
bisweilen groteske Züge an. Immerhin liest man in Rock- und Metal-Foren
oft genug davon, dass auch dieses Album so manchem durch sehr dunkle
Zeiten in seinem Leben geholfen habe.
Dadurch mag „Temple of the Dog“ auf den ersten Eindruck
stellenweise nur wenig zugänglich wirken, etwa wenn ein
jamsessionartiger Elfminüter wie „Reach Down“ gleich an die zweite
Position gesetzt wird, wo er im Sinne eines durchkalkulierten
Hit-Albums eigentlich eher „stören“ würde. Aber dann folgen ja bereits
„Hunger Strike“ mit Gastsänger Eddie Vedder, die balladesken Stücke
„Call me a Dog“ und „Times of Trouble“ und alles ist gut. Es mag sein,
dass diese Art von Musik keine ausgelassene Party-Stimmung versprüht,
jede Fröhlichkeit vermissen lässt, aber das über Jahre anhaltende
Bashing als vermeintliche Depri-Mucke seitens „echter“ Rocker nahm
bisweilen groteske Züge an. Immerhin liest man in Rock- und Metal-Foren
oft genug davon, dass auch dieses Album so manchem durch sehr dunkle
Zeiten in seinem Leben geholfen habe.
Neben den bekannten Songs wie dem erwähnten „Hunger Strike“ (durch den
Videoclip damals ziemlich präsent) überzeugen auch die eher in der
zweiten Reihe agierenden, bisweilen etwas sperrigen Stücke wie „Your
Saviour“, wodurch sich am Ende bei immerhin 55 Minuten Spielzeit ein
Album ergibt, das nicht von zwei, drei Hit-Singles mit beigefügtem
Füllmaterial leben muss, um auf LP-Länge zu kommen. Die Verfügbarkeit
auf Tonträgern ist angesichts der namhaften Beteiligten auch heute noch
kein Problem – es sei denn, man ist LP-Freund und orientiert sich an
den durchaus saftigen Preisen für zeitgenössische Vinyl-Ausgaben, die
auf Plattformen wie Discogs verlangt werden (was auch für jüngere
Reissues gilt, für die man ebenfalls tief in die Tasche greifen muss).
Auf CD gibt’s das Ganze für unter zehn Euro, was nicht nur als
Anti-Preistreiber-Alternative mehr als in Ordnung geht.
-Stefan - 11/2021
 Der offensichtliche, aber auch etwas abgeschmackte Einstieg
in einen Text über Ludwig Hirsch wäre schon die Auswahl des
vorzustellenden Albums gewesen, nämlich die zweite Platte von 1979 mit
dem später als prophetisch missverstandenen Titel „Komm großer
schwarzer Vogel“ – weil Hirsch vor zehn Jahren, bereits schwer
erkrankt, durch Freitod aus dem Leben schied (und der Text des
Titelstücks so eng mit seinem eigenen Ende verbunden zu sein schien,
dass es einem gruselig zumute werden mag).
Der offensichtliche, aber auch etwas abgeschmackte Einstieg
in einen Text über Ludwig Hirsch wäre schon die Auswahl des
vorzustellenden Albums gewesen, nämlich die zweite Platte von 1979 mit
dem später als prophetisch missverstandenen Titel „Komm großer
schwarzer Vogel“ – weil Hirsch vor zehn Jahren, bereits schwer
erkrankt, durch Freitod aus dem Leben schied (und der Text des
Titelstücks so eng mit seinem eigenen Ende verbunden zu sein schien,
dass es einem gruselig zumute werden mag).
Aber das wäre zu kurz und zu sehr an der Oberfläche gedacht. Der Sänger und Schauspieler Ludwig Hirsch war nicht etwa ein durch und durch nur am Morbiden hängender Künstler, seine Texte sind auch durchzogen von einem schwarzen Alltagshumor, hinter dem eine große Beobachtungsgabe mit Blick auf menschliche Schwächen und Abgründe steckt. Aber damit wir uns richtig verstehen: Moll ist auch auf Hirschs Debüt „Dunkelgraue Lieder“ die vorherrschende Klangfarbe, da gibt es viel Melancholisches und Trauriges, aber eben gerne in ein sanftes melodisches Gewand verpackt, wodurch die Songs trotz der teils harten und tragischen Inhalte auch etwas Tröstliches in sich tragen.
Der ambivalente Blick auf die verstorbene „Omama“ im Eröffnungsstück bringt das gleich zu Beginn auf den Punkt, gefolgt vom wohl morbidesten Titel der LP: „I lieg am Ruckn“ – geschrieben in Ich-Perspektive als Leiche im Sarg, die dort Rückschau hält auf eine vergangene Beziehung und bemerken muss, wie ihr schön langsam die Würmer ins Hirn kriechen und dort ein Festmahl beginnen. Ein grausiges Detail? Nun, vielleicht auch deshalb, weil man im Gegensatz zu den inbrünstig gegrunzten Ausweidungsphantasien zumeist auf Englisch singender Death-Metal-Gruppen alles wunderbar deutlich verstehen und sich vergegenwärtigen kann.
Ganz so genau will man dann doch lieber nicht wissen, was sich wohl „Der Herr Haslinger“ so alles vorstellt, wenn er den Lausbuben in den kurzen Lederhosen und den Mäderln in den kurzen Röckchen hinterherschaut, bis er am Ende eins von den Kindern, die er so gern hat, vermutlich umbringt. Da gibt es textlich so manche bittere Pille zu schlucken wie in „Der Dorftrottel“, wenn ein ländlicher Lynchmob über einen Unschuldigen herfällt und ihn umbringt. Anheimelnd melancholisch ist das keineswegs mehr, sondern bemerkenswert hart und näher an der Realität als das, was gerne schönfärberisch als die „gute alte Zeit“ verniedlicht wird.
Mit dieser Scheibe ins Hirsch-Gesamtwerk einzusteigen, ist sicher
keine ausgefallene Wahl, weil sie nun einmal den Klassiker in seinem
Schaffen darstellt. Aber man kauft sich bei Celtic Frost ja auch nicht
als Erstanschaffung „Cold Lake“, nur um besonders originell dazustehen.
Die CD gibt es wie den Nachfolger jeweils für wenig Geld, während beide
zusammen auch in der „Liederbuch“-Reihe erschienen sind. Dort ist
übrigens die LP-Variante zu bevorzugen, denn das schön gestaltete
Doppel-Vinyl mit Texten enthält die kompletten beiden Longplayer (mit
20 Tracks), während es die „Liederbuch“-CD nur auf 13 Stücke mit einer
Auswahl aus den beiden Alben bringt. Das wird Kapazitätsgründe gehabt
haben und wäre mit einer zweiten Scheibe leicht zu beheben gewesen. Ist
aber nicht weiter schlimm, das Vinyl macht sich ohnehin besser im
Plattenschrank.
Video "I lieg am Ruckn" - geht nur extern
- Stefan - 11/2021

 Besonders lange existierte die 1980 gegründete
Band GRAUZONE nicht: Aus dem Punk kommend, der auch in der Schweiz eine
neue kreative Szene beförderte (nachzuhören unter anderem auf dem
„Swiss Wave“-Sampler), war zwei Jahre später schon wieder Schluss.
Produziert wurden gerade mal ein Longplayer und diverse Singles, auch
Live-Auftritte gab es nur wenige. Dennoch haben GRAUZONE ihre Spuren
hinterlassen: nicht nur wegen ihres Hits „Eisbär“ (den die Band gerade
live gerne vermied), sondern auch durch die Mitwirkung von Stephan
Eicher, der danach vor allem als Solo-Künstler von sich reden machte.
Konzerte außerhalb der Schweiz fanden nicht statt, ein Auftritt in der
Stuttgarter „Mausefalle“ (wo 1982 auch das Live-Album von TRIO
entstand) wurde abgesagt.
Besonders lange existierte die 1980 gegründete
Band GRAUZONE nicht: Aus dem Punk kommend, der auch in der Schweiz eine
neue kreative Szene beförderte (nachzuhören unter anderem auf dem
„Swiss Wave“-Sampler), war zwei Jahre später schon wieder Schluss.
Produziert wurden gerade mal ein Longplayer und diverse Singles, auch
Live-Auftritte gab es nur wenige. Dennoch haben GRAUZONE ihre Spuren
hinterlassen: nicht nur wegen ihres Hits „Eisbär“ (den die Band gerade
live gerne vermied), sondern auch durch die Mitwirkung von Stephan
Eicher, der danach vor allem als Solo-Künstler von sich reden machte.
Konzerte außerhalb der Schweiz fanden nicht statt, ein Auftritt in der
Stuttgarter „Mausefalle“ (wo 1982 auch das Live-Album von TRIO
entstand) wurde abgesagt.
Zu ihrem Namen inspirierte die Band (meines Wissens) der im Jahr 1979
veröffentlichte gleichnamige Film von Fredi Murer (international später
vor allem durch sein meisterhaftes Drama „Höhenfeuer“ von 1985
bekannt). Der Protagonist des in tristem Schwarz-Weiß gehaltenen Films
betätigt sich, verborgen hinter einer normalbürgerlich wirkenden
Existenz, mit Abhöraktionen für einen Konzern. Während sich zeitgleich
eine mysteriöse Epidemie ankündigt, nehmen sowohl persönliche Isolation
wie auch gesellschaftliche Entfremdung zu, was als Anknüpfungspunkt für
die Stimmung, die von GRAUZONEs Musik und Texten ausgeht, eine nicht
unbedeutende Rolle gespielt haben dürfte.
Ende der Neunziger kam mit „Die Sunrise Tapes“ eine erste Compilation
auf den Markt, zwölf Jahre gefolgt von einer zweiten Zusammenstellung
mit zusätzlichen Stücken (die jedoch den Song „Schlachtet!“ vermissen
lässt, auf der hier vorgestellten CD noch vertreten). Musikalisch
bedienten GRAUZONE ein durchaus breiter gefasstes Spektrum, obwohl sie
eigentlich einen minimalistischen Sound ohne besonderen Aufwand
pflegten, bei dem trotz der Unterschiede die Stücke klar zuzuordnen
sind. Was wiederum nahelegt, dass GRAUZONE ein sehr stabiles Zentrum
gehabt haben müssen, das ihre Identität zusammenzuhalten schien.
 Die CD beginnt mit zwei der bekanntesten Tracks, nämlich
dem monoton hämmernden „Film 2“ (hierzu wurde ein Video gedreht und
auch in einer Folge von „Ein Fall für zwei“ fand das Stück Verwendung)
und natürlich dem unvermeidlichen „Eisbär“, den die meisten vermutlich
als damaligen Charts-Hit kennen oder von einem der vielen NDW-Sampler.
Dem stehen auch andere, nicht sofort eingängige Songs gegenüber,
während „Wütendes Glas“ (dem frühen bis mittleren DAF-Sound recht nahe)
auch die morsch gewordenen Tanzbeine älterer Herrschaften wieder zum
Schwingen bringt. Schade nur, dass das brillante „Kunstgewerbe“ der
beiden Eicher-Brüder mit knapp über einer Minute Spielzeit lediglich
den Charakter eines Intermezzos besitzt, davon hätte man gerne noch
mehr gehört. Auch in der Folge wechseln sich düstere Klänge mit
eingängigen Songs ab, was sich in der Instrumentierung (mal
gitarrenlastiger, mal mehr Synthies) niederschlägt.
Die CD beginnt mit zwei der bekanntesten Tracks, nämlich
dem monoton hämmernden „Film 2“ (hierzu wurde ein Video gedreht und
auch in einer Folge von „Ein Fall für zwei“ fand das Stück Verwendung)
und natürlich dem unvermeidlichen „Eisbär“, den die meisten vermutlich
als damaligen Charts-Hit kennen oder von einem der vielen NDW-Sampler.
Dem stehen auch andere, nicht sofort eingängige Songs gegenüber,
während „Wütendes Glas“ (dem frühen bis mittleren DAF-Sound recht nahe)
auch die morsch gewordenen Tanzbeine älterer Herrschaften wieder zum
Schwingen bringt. Schade nur, dass das brillante „Kunstgewerbe“ der
beiden Eicher-Brüder mit knapp über einer Minute Spielzeit lediglich
den Charakter eines Intermezzos besitzt, davon hätte man gerne noch
mehr gehört. Auch in der Folge wechseln sich düstere Klänge mit
eingängigen Songs ab, was sich in der Instrumentierung (mal
gitarrenlastiger, mal mehr Synthies) niederschlägt.
Um den GRAUZONE-Kosmos kennenzulernen, ist die CD auf jeden Fall gut
geeignet, wenn es nicht gleich das aktuelle Vinyl-Set „40 Years
Anniversary“ (mit Studio-Album und Live-Scheibe) sein soll oder die
vergriffene Doppel-CD „1980-1982“ (da wird es preislich jeweils schon
etwas deftiger). Wer dann aber auf den Geschmack gekommen ist, der wird
sich wohl zwangsläufig auch noch den kostspieligen Rest anschaffen
müssen, wenn man auf Stücke wie „Tanz mit dem Tod“ oder „Film 1“ nicht
verzichten möchte.
- Stefan - 11/2021
 Wer die späten Achtziger als Musikhörer in
Bayern verbracht hat, dürfte kaum an ihm vorbeigekommen sein: Georg
Ringsgwandl, seinerzeit gerne mit dem Attribut „schrill“ belegt,
brachte 1986 sein erstes Album heraus, auf dem sogar ein ausgefallenes
Hendrix-Cover („Der Wind schreit Scheiße“) seinen Platz fand. Als
Ringsgwandls Durchbruch habe ich damals den Nachfolger „Trulla!
Trulla!“ von 1989 wahrgenommen, mit Songs wie „Wuide unterwegs“ und dem
„Heavy Metal Landler“, die kunterbunt alles miteinander vereinten,
seien es Reggae-Rhythmen, schrammelnde Rock-Gitarren oder bayerische
Volksmusik.
Wer die späten Achtziger als Musikhörer in
Bayern verbracht hat, dürfte kaum an ihm vorbeigekommen sein: Georg
Ringsgwandl, seinerzeit gerne mit dem Attribut „schrill“ belegt,
brachte 1986 sein erstes Album heraus, auf dem sogar ein ausgefallenes
Hendrix-Cover („Der Wind schreit Scheiße“) seinen Platz fand. Als
Ringsgwandls Durchbruch habe ich damals den Nachfolger „Trulla!
Trulla!“ von 1989 wahrgenommen, mit Songs wie „Wuide unterwegs“ und dem
„Heavy Metal Landler“, die kunterbunt alles miteinander vereinten,
seien es Reggae-Rhythmen, schrammelnde Rock-Gitarren oder bayerische
Volksmusik.
Nach drei Alben bis 1992 folgte dann eine Zäsur mit der Akustik-CD
„Staffabruck“, auf der vor allem Stücke aus den Siebzigern versammelt
waren. Der Titel der Scheibe verweist auf Ringsgwandls Herkunft und
Heimat, die Texte erzählen von nicht immer nur schönen Erlebnissen aus
der Kindheit, von anderen dunklen Momenten und von merkwürdigen
Figuren, die man gut nachvollziehen kann, wenn man selbst auf dem Land
aufgewachsen ist. Der Einstieg mit „Kneißl“ (über den 1902
hingerichteten Räuber Mathias Kneißl) ist etwas schwierig, da der Text
sich an den populären volkstümlichen Legenden orientiert, die schon zu
Kneißls Lebzeiten kursierten und irgendwie doch etwas zu
schönfärberisch daherkommen.
Die übrigen Texte durchzieht ein überwiegend nachdenklicher Tonfall und
auch musikalisch setzt Ringsgwandl von Ausnahmen („Auf der Straß“)
abgesehen meist auf die ruhige Gangart. Damit ist „Staffabruck“
natürlich wie geschaffen für die Herbst- und Winterzeit, auch wenn es
mit der Textverständlichkeit für Hörer nördlich von Bayern
möglicherweise problematisch werden könnte. Nach fast 30 Jahren muss
man konstatieren, dass sich das Album ziemlich gut gehalten hat und
auch Ringsgwandl-Anhänger, die seinerzeit, unterstützt durch markante
Liveauftritte, in erster Linie die wildere und rockigere Musik der
vorhergehenden Alben kannten, den stilleren Weg von „Staffabruck“
offensichtlich mitgegangen waren.
Da der Musik alles Krachlederne abgeht und auch durch die
Instrumentierung sich möglicherweise anbietende „Alpenrock“-Klischees
vermieden werden konnten, hat „Staffabruck“ etwas von dem mitbekommen,
was gerne als „zeitlos“ beschrieben wird. Da verweist im Grunde nichts
weder musikalisch noch textlich in besonderer Weise auf die
Entstehungszeit der meisten Lieder, die statt in den Siebzigern auch
zwanzig Jahre später hätten geschrieben worden sein können (also in der
Zeit, als sie schließlich aufgenommen wurden). Ringsgwandls Texte
berühren hier existenzielle Themen und das wird wohl der Grund sein,
weshalb das Album auch nach vielen Jahren unter seinen Anhängern noch
einen besonderen Stellenwert hat.
- Stefan - 11/2021

 Die letzte Station unserer diesjährigen Herbstmusik-Strecke
hat, so weit entfernt das musikalisch zunächst aussehen mag, auch etwas
mit dem Black Metal der Achtziger und Neunziger aus Norwegen zu tun.
Schenkt man den Mord-und-Totschlag-Anekdoten Glauben, so war „Cyborg“
jenes Album, das zuletzt auf dem Plattenteller des MAYHEM-Gitarristen
Euronymous lag, als dieser in der Nacht des 10. August 1993 ermordet
wurde. Das Elektronik-Faible des Musikers war durchaus bekannt: So
hatte er in den Achtzigern den Kontakt zu Conrad Schnitzler gesucht,
der dann ein Stück beisteuerte, das zum Intro des Mayhem-Mini-Albums
„Deathcrush“ wurde. Beide, Schulze und Schnitzler (klingt fast wie ein
Duo aus einem MAD-Comic), waren in der frühen Phase auch Mitglieder der
später zu Weltruhm gelangenden Band TANGERINE DREAM, bevor sie eine
Solokarriere einschlugen.
Die letzte Station unserer diesjährigen Herbstmusik-Strecke
hat, so weit entfernt das musikalisch zunächst aussehen mag, auch etwas
mit dem Black Metal der Achtziger und Neunziger aus Norwegen zu tun.
Schenkt man den Mord-und-Totschlag-Anekdoten Glauben, so war „Cyborg“
jenes Album, das zuletzt auf dem Plattenteller des MAYHEM-Gitarristen
Euronymous lag, als dieser in der Nacht des 10. August 1993 ermordet
wurde. Das Elektronik-Faible des Musikers war durchaus bekannt: So
hatte er in den Achtzigern den Kontakt zu Conrad Schnitzler gesucht,
der dann ein Stück beisteuerte, das zum Intro des Mayhem-Mini-Albums
„Deathcrush“ wurde. Beide, Schulze und Schnitzler (klingt fast wie ein
Duo aus einem MAD-Comic), waren in der frühen Phase auch Mitglieder der
später zu Weltruhm gelangenden Band TANGERINE DREAM, bevor sie eine
Solokarriere einschlugen.
Wer das TD-Doppelalbum „Zeit“ kennt, der erhält auch eine Vorstellung
davon, was ihn auf „Cyborg“ erwartet: Die Musik war hier noch nicht in
jener Phase angelangt, in der treibende, vom Sequenzer angetriebene
Rhythmen das Klangbild prägten, sondern raumgreifende „Flächen“ die
Kompositionen bestimmten. Das mag zunächst in der Tat abschreckend
wirken, denn für den Hörer, der anders strukturierte Stücke gewohnt
ist, findet ein Kurs der radikalen Entschleunigung statt. Die
einzelnen, sehr langen Tracks dauern 23 bis 25 Minuten und bestehen aus
vorproduzierten Orgel- und Streicherklängen, die eine Symbiose mit den
permanent umherflirrenden Synthie-Klängen eingehen, was eine
ungewöhnliche, beinahe meditative Wirkung auslöst. Hat einen dieser
Sound erst einmal für sich eingenommen, vermag man ganz in ihm
aufzugehen.

Ebenso wie bei Tangerine Dream findet auch bei Klaus Schulze dieser
Abschnitt des musikalischen Schaffens keinen ungeteilten Beifall. Der
Kritikpunkt von zu großer Monotonie und Langatmigkeit ist ja
nachvollziehbar, auch wenn ich eher den Versuch unternehmen würde, das
Album aus seinem historischen Kontext zu verstehen, als ein Werk des
Experimentierens und Findens. Auch KRAFTWERK klangen auf ihren ersten
Alben ganz anders als in den ausgehenden Siebzigern, als sich Stil und
Ausdruck etabliert hatten. Außerdem erweist sich „Cyborg“ als
ausgezeichneter Soundtrack für nächtliche Listening Sessions, wenn
draußen der erste frühwinterliche Schnee fällt und sich eine
eigentümliche Stimmung einstellt. Ein Kritiker auf den babyblauen
Seiten schrieb dazu: „…wie eine Kathedrale aus Eis … kristallklar und
faszinierend.“
Das Album ist in zwei Covervarianten erhältlich, wobei die Foto-Ausgabe
eindeutig die prägnantere ist: Schulze steht hier vor einem rot-schwarz
gemusterten erleuchteten Hintergrund, Name und Albumtitel sind in
Orange bzw. Gelb gehalten. Ein perfektes Artwork, das Klarheit und
Mysterium gelungen miteinander vereint.
- Stefan - 12/2021